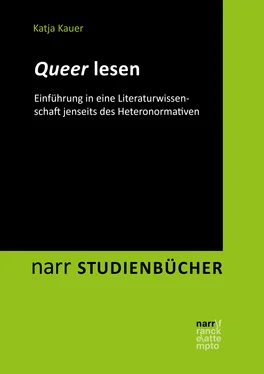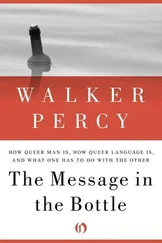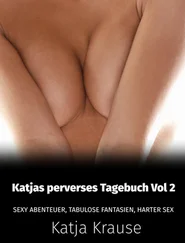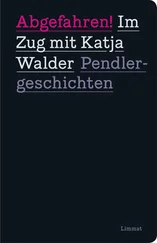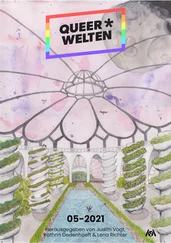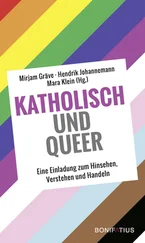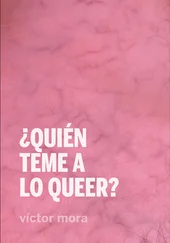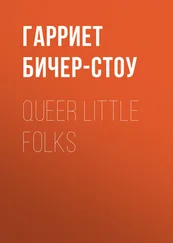1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Die Femme fatale und die Femme fragile sind die beiden für das Fin de siècle charakteristischen Imaginationen des Weiblichen, in denen sich vor allem sexuelle Wünsche und Ängste figurieren. Während die Femme fragile einen sublimierten Eros verkörpert, eine ideal überhöhte, verklärte, entkörperte Sexualität, stellt die Femme fatale eine übersteigerte, meist in ein exotisches Gewand gehüllte Form der Erotik vor, die dämonisiert wird. Diese beiden Bilder des Weiblichen sind Männerphantasien, die in einem misogynen Zug des Denkens fundiert sind.4
Es ist von erotischen Wünschen und Verwicklungen die Rede, von den Sehnsüchten nach Ausbruch aus der starren Welt und von den Gefahren, die die Übertretung von sittlichen Grenzen für die Figuren bedeutet. Über psychologisierende Einblenden lassen die Texte Figuren entstehen, die ihre Subjektivität in dem strengen Raster von Standes- und Geschlechternormen entwickelt haben und die in ihrem Aufbegehren eigentlich nur die Unmöglichkeit einer tatsächlichen Flucht vor den Direktiven, denen sie sich innerhalb ihrer altadeligen Welt zu beugen haben, deutlich machen. Dass diese Normen in Bezug auf das geschlechtliche Verhalten binär gesetzt sind, also gemäß einer strikten Zweiteilung von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ in den Texten etabliert werden, verwundert nicht. Sind die Frauenfiguren in der adligen Welt zurückgezogen, fragil, künstlerisch begabt, nur im bescheidenen Maß fertil, bestechen die kontrastierenden Männerfiguren durch Lebensechtheit, praktischen Sinn, erotische Kraft und Potenz. Die konkreten Figurationen sind zwar von Text zu Text verschieden, dass die männlichen und weiblichen Figuren als Gegensatzpaare auftreten, bleibt jedoch immer unverkennbar. Deutlich ist auch, dass Frauen als – einmal verehrte, einmal verachtete – Sexualobjekte dienen. Sie lösen das Begehren aus und die Männer leben es aus. Während nämlich in fast allen Texten Keyserlings den Männern aufgetragen ist, ihre als ‚natürlich‘ geltende Männlichkeit, sprich den Hang zur Promiskuität und ihren Freiheitsdrang, in den Nischen, die der adlige Kosmos zur Verfügung stellt, beispielsweise mit Hausmägden, Künstlerinnen oder gesellschaftlich verfemten Frauen auszuleben, ist für die weiblichen Figuren der Adelswelt diese Möglichkeit verschlossen und wird von ihnen auch nicht vermisst: Die weiblichen Figuren zeigen oft kein eigenes Begehren. Sie begnügen sich damit, den an sie gestellten häuslichen Anforderungen in feiner Garderobe, Handarbeiten verrichtend oder Romane verschlingend gerecht zu werden. Ende des 19. Jahrhunderts galt der Sexualtrieb bereits als etwas Naturgegebenes. Aus diesem Grund erscheinen die allzu reinen ,weißen‘ Frauen zwar verehrungswürdig, doch degeneriert, der Autor, der sie erdacht hat, zeigt ihnen gegenüber oft Mitgefühl. Die Frauen wirken wie eingesperrt und scheinen den Schlüssel zu ihrer Befreiung entweder nicht zu finden oder in falsche Hände zu legen. Den adligen, meist ‚weißen‘ Frauen entspricht es in dieser streng geschlechtlich-dualen Welt, den rein privaten Raum zu besetzen, der von ihren Männern für die weiblichen Wesen reserviert wurde. Für ein Leben jenseits der häuslichen Grenze sind sie nicht geschaffen. Junge Frauen, die noch vor dem Eintritt in die Mutterschaft stehen, werden als Sehnsuchts- und Begehrensobjekte stilisiert und unterstehen einer sinnlichen Funktion, ältere Frauen agieren entweder altjüngferlich oder mütterlich, ihnen kommt vor allem die häusliche Funktion zu. Auch der Roman Wellen hält an diesem Schema fest. Mann und Frau sind gänzlich verschieden. Die Bedürfnisse der Geschlechter ergänzen sich nur schlecht, so dass in die heterosexuellen Beziehungen ein Scheitern eingeschrieben ist.
Anlässlich einer Neuausgabe des 1911 erschienenen Romans Wellen entstanden Rezensionen, die eine schwärmerische Ode auf Eduard von Keyserling singen. Er wurde gar als „besser als Fontane!“ bezeichnet.5 Die Rezension aus dem Jahr 2011 zeugt von einem neu erwachenden Interesse an dem Autor. Dieses Interesse an Keyserling besteht bereits seit mehr als 20 Jahren, behauptet Jin Ho Jong in einer Arbeit zu Keyserling aus dem Jahr 2006:
Die vielzitierte Äußerung Jens Malte Fischers von 1974, daß Keyserling „der wahrscheinlich unbekannteste große deutsche Erzähler“ des zwanzigsten Jahrhunderts sei, scheint nicht mehr haltbar zu sein. Denn die in den letzten zwanzig Jahren ständig gestiegene Anzahl neuer Ausgaben seiner literarischen Werke und wissenschaftlichen Arbeiten über ihn deutet darauf hin, daß Keyserling von den Lesern und der Wissenschaft neu entdeckt wird: In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen insgesamt elf neue Ausgaben und in den 90er Jahren siebzehn, während es in den 70er Jahren lediglich sechs neue Ausgaben gab. In diesem Zeitraum wurden auch deutlich mehr wissenschaftliche Arbeiten zu Keyserling veröffentlicht, so daß von einer Vergessenheit keine Rede mehr sein kann.6
Die Neuausgabe und Rezension von 2011 sind Ausdruck eines schon vorher bestehenden Interesses an dem Autor Keyserling. Die Inhaltsangabe des Romans Wellen hält der Rezensent Michael Maar, den ich hier exemplarisch anführe, kurz:
Die Handlung tut überhaupt nichts zur Sache, obwohl auch sie schön ausgedacht und nicht ganz ohne Überraschung ist. Die junge Frau mit den zu vollen Lippen hat ihren alten adligen Gatten verlassen und ist mit einem Maler Hans durchgebrannt. Das von der Gesellschaft geächtete Paar, das in einer Fischerhütte an der Ostsee lebt, weckt allerhand romantische und sinnliche Motionen aufseiten der zur Sommerfrische versammelten Familie der Generalin von Palikow. Vor allem die Männer, allesamt liiert, verfallen dem Reiz der durchgebrannten Gräfin, die zumindest einen von ihnen somnambul gewähren lässt.7
Auf einem queeren Blick scheint das neu erwachte Interesse aber nicht zu beruhen. Selbst eine genderorientierte Analyse über die Konstruktionen des Weiblichen und Männlichen im Prosawerk Eduard von Keyserlings , in der durchaus konstatiert wird, dass die Frauenfiguren brüchig sind, das heißt widersprüchlich erscheinen8, und dass sich in den heterosexuellen Beziehungen Ambivalenzen zeigen, die durch problematische Asymmetrien hervorgerufen sind,9 verbindet diese Thesen nicht mit dem Wort queer . Was an Keyserling fasziniert, steht bisher keineswegs mit der Forschungsrichtung in Zusammenhang, die ebenso jung ist wie das seit den 80er Jahren gewachsene Interesse an dem baltischen Autor.
Soll nun ein solcher Text wirklich zum Gegenstand einer queeren Lektüre gemacht werden, in dem eine durchgebrannte, sinnliche Gräfin körperliche Begierde in liierten, liebeskranken Männern weckt? Hat dieser Text, der von einer völlig heteronormativ verfassten Welt erzählt, ein queeres Potential? Ja, denn die schöne junge Frau ruft, folgen wir der kurzen Inhaltsangabe, auf Seiten der gesamten Familie „sinnliche Motionen“ wach. Wenn auch „vor allem die Männer“, so heißt es in der Zusammenfassung des Rezensenten, der schönen jungen Frau verfallen, verspricht diese adverbiale Betonung doch auch, dass nicht nur Väter, Söhne und andere männliche Ostseebadbesucher, sondern auch die anwesenden Frauen ihre romantischen Wünsche auf die „zu vollen Lippen“ der hübschen Gräfin projizieren. Diese Inhaltsangabe vermag eine queere Lektüre zumindest sinnvoll erscheinen zu lassen. Tatsächlich werden wir, wenn wir uns dem Text nähern, sehen, dass sich besonders eine Frau von Doralice so fasziniert zeigt, dass wir ohne Weiteres von ‚Entflammtsein‘ und ‚Verliebtheit‘ sprechen können. Von dieser Frauenbeziehung schweigt die Rezension jedoch: Sie verhandelt unter Stichwörtern wie „Paarstudie“ die Beziehungen ‚heterosexueller‘ Paare in einer heteronormativ verfassten Welt und lässt keine queeren Inhalte des Romans vermuten. Eine andere aufschlussreiche Rezension zu Keyserling, die eigentlich für die Erzählung Schwüle Tage wirbt, sagt über Wellen :
Читать дальше