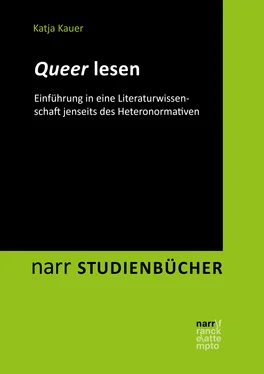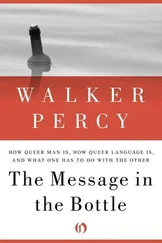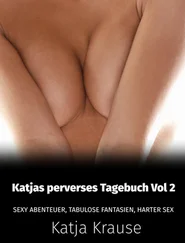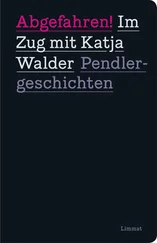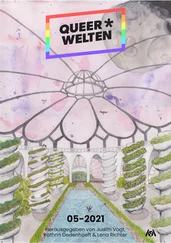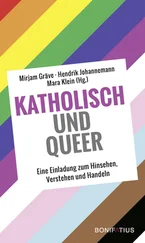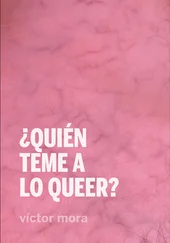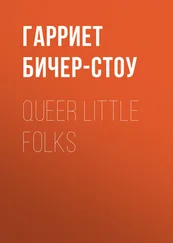Dieses Festhalten an der einmal getroffenen Entscheidung entspricht wiederum dem Topos von Ehebruchsgeschichten des 19. Jahrhunderts. Die Ehebrecherin möchte vor sich und der Gesellschaft, trotz ihres Konventionsbruchs, nicht als flatterhaft erscheinen. Im Grunde genommen entspricht Doralice dem passiven, domestizierten Typus des Weiblichen, denn im Rahmen der Romanhandlung weiß sie ihre sexuellen Wünsche, einer Dame von Stand angemessen, anders als die männlichen Figuren durchaus zu zügeln. Natürlich fühlt sie sich zu Hilmar hingezogen, mehr als zu dem Mann, für den sie ihr bisheriges Leben aufgab, aber weder hat sie im Sinn noch fühlt sie sich berechtigt, der jungen Freundin und Bewunderin Lolo den Verlobten auszuspannen. Dass sie Grill einst gefolgt ist, scheint weniger Ausdruck ihres eigenen primären Begehrens gewesen zu sein, sondern ihre Passivität und Unentschlossenheit lässt vermuten, dass sie einfach nicht in der Lage war, der vehementen Werbung des potenten jungen Mannes, eines Gegenbildes des greisen Ehemanns, standzuhalten. Sie fiel ihrer Unentschlossenheit und Schicksalsergebenheit zum Opfer und musste deshalb dem folgen, der am rücksichtslosesten um sie warb. Erst Grill hat sie im sexuellen Sinn zur Frau gemacht und als eine solche wird sie mehr begehrt als dass sie selbst Begehren zeigt. Den Fehler, sich ihrer eigenen Geschlechtlichkeit (als sexuelles Objekt) auszuliefern, will sie keineswegs wieder begehen. Hilmar wirkt nicht so stark auf sie, dass diese Gefahr droht. Wünschen und Sehnsüchten traut Doralice nicht. Sie braucht feste Strukturen, die ihr Halt geben. Haltlosigkeit wird in Wellen auch als typische Qual des Weiblichseins dargestellt. Doralices Sehnsucht nach einer strukturverheißenden männlichen Hand baut auf der Prämisse auf, dass Frauen weder einen eigenen Lebensplan noch ein authentisches Begehren aufweisen. Sie sind Fähnchen im Wind. Ihre Schönheit macht sie angreifbar, unfrei, und was und wen sie wirklich lieben, bleibt rätselhaft.
Diese mustergültige Entgegensetzung von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘, die in einer Vorstellung von Heterosexualität kulminiert, die völlig phallozentrisch definiert ist, das heißt allein Männern die Fähigkeit zukommen lässt, aktiv zu begehren, zu werben und die begehrte Frau zu erobern, wird an einer Stelle allerdings nachhaltig gebrochen. Doralices Erotik, die in gewisser Weise selbstbezogen und ohne authentische Lüste ist, erregt eben nicht nur die männliche Aufmerksamkeit. Spiegelt ihr jedoch eine andere Frau zurück, wie begehrenswert sie ist, droht der schönen, widerstandslos in den Grenzen ihres Geschlechts gefangenen Doralice keine Gefahr. Im Gegenteil: Sie kann sich für einen Augenblick von den Grenzen, die die Konventionen ihr setzen, befreien. Lolo, die Tochter der Buttlärs, fühlt sich zu der schönen Frau ebenso leidenschaftlich hingezogen wie die Männer um sie herum. Dies ist zunächst nicht weiter bemerkenswert; es gehört zum Topos der strengen Geschlechtersegregation, dass junge, gerade gesellschaftlich debütierende Mädchen für bereits verheiratete Frauen schwärmen. In Anna Karenina wird daraus sogar ein Lehrsatz abgeleitet. Kitty, die Frau, die Wronski zugunsten Annas aufgibt, ist eine glühende Verehrerin von Annas Reizen, eine Verehrung, die ins Gegenteil umschlägt, als sie in Anna eine Nebenbuhlerin erkennt.
Anna war augenscheinlich entzückt von dem schönen jungen Mädchen, und ehe Kitty sich noch recht besinnen konnte, fühlte sie, dass sie nicht nur in Annas Bann geraten war, sondern sich auch in sie verliebt hatte, wie sich eben junge Mädchen in verheiratete Frauen, die etwas älter sind als sie, zu verlieben fähig sind.17
Auch die deutsche realistische Autorin Marie von Ebner-Eschenbach, die eher als moralinsauer gilt und wie Keyserling das Etikett ‚konservativ‘ trägt, hält das Modell der schwärmerischen Jugendliebe einer jungen Frau zu einer etwas älteren für einen Allgemeinplatz. In einem 1893 als Kleiner Roman veröffentlichten Text erzählt eine ehrenwerte, äußerst anerkannte Hofrätin von der Schwärmerei ihrer Jugendjahre, die sie als ein allgemein weibliches Phänomen ansieht:
Haben Sie nicht auch einmal in frühen Mädchenjahren einen Fanatismus der Liebe und Bewunderung für eine etwas ältere Frau in sich genährt, die Ihnen der Inbegriff aller Herrlichkeit schien? Es kommt oft vor in den Ausläufern der Backfischzeit. Einen solchen Götzendienst trieb ich im Stillen mit der Gräfin. Ich hätte mich auf die Folter spannen lassen, um ein freundliches Wort von ihr zu verdienen […].18
Die männerdominierte Gesellschaft hat kein Problem damit, wenn sich die noch nicht im Ehestand domestizierte jugendliche (A)Sexualität der Mädchen ‚Begehrensobjekte‘ innerhalb ihres eigenen homosozialen Raumes sucht. Das Patriarchat hat eine hohe Toleranzschwelle gegenüber dieser sich so harmlos ausnehmenden femininen Zärtlichkeit zueinander. Diese Allianzen, so erzählt es auch Effi Briest ,19 brechen mit dem Eintritt der jungen Frauen in die Ehe. In gewisser Weise ist diese homosoziale Idealisierung der Mädchen untereinander sogar ein Vehikel der patriarchalischen Sexualmoral, um die Jungfräulichkeit der Mädchen zu bewahren, weil sie die Lüste der jungen Mädchen vom Einbruch des Männlichen reinhält. Wie von Lilian Faderman und Karin Lützen, auf die in der Einleitung referiert wird, dargestellt wurde, ist dieses Begehren völlig gefahrlos, solange Frauen als asexuell gelten. Was aber – ähnlich wie lesbische Pornographie, die allein für einen männlichen Konsumenten inszeniert wurde – als Stütze einer frauenfeindlichen Sexualmoral angesehen werden kann, hat doch das Potential der Brechung: Lolos Schwärmerei nämlich, die auf den ersten Blick für den Leser und die Leserin zu Beginn des 20. Jahrhunderts nichts Atypisches aufweist, ist nur scheinbar den gängigen Konventionen angepasst, in ihr scheint die Subversion der sexuellen Repression auf. Lolo hatte bereits das Vergnügen, die undurchsichtige, schlecht beleumundete Frau aus der Ferne zu beobachten, als sich beide, abseits von den anderen, beim Schwimmen auf einer Sandbank begegnen. Diese Begegnung sollten wir einem close reading unterziehen. Sie ist wie folgt beschrieben:
„Wer geht denn dort ins Meer?“ fragte Wedig und zeigte zum Strande hinab.
„Das“, sagte die Generalin, „muß die Köhne sein.“ […]
„Reizend“, bemerkte Fräulein Bork, „marineblau und einen kleinen gelben Dreimaster, und wie die schwimmt!“
„Sehr schick“, brummte Wedig. Das jedoch erregte aufs neue Frau von Buttlärs Aufregung. „Schweig“, herrschte sie ihren Sohn an, sie stand auf, schwenkte ihr Tuch, rief wieder „Lolo, Lolo! Aber sie schwimmen ja aufeinander zu, auf der Sandbank müssen sie sich ja treffen. Ach Gott, armes Kind!“
„Na setz dich, Bella“, beruhigte die Generalin ihre Tochter, „jetzt ist es nicht zu ändern. Sie wird Lolo auch nicht gleich anstecken.“
[…]
„Die Dame ist doch zuerst da“, rief Wedig triumphierend.
„Lolo scheint müde, sie schwimmt langsam“, bemerkte Fräulein Bork; „ah, ah, die Gräfin geht ihr entgegen, sie will ihr helfen.“
„Unerhört“, stöhnte Frau von Buttlär. „Jetzt reicht sie Lolo die Hand“, meldete Wedig, „ah, jetzt steht Lolo, die Dame legt ihr den Arm um die Taille, und Lolo stützt sich auf ihre Schulter.“
[…]
Lolo stand drüben auf der Sandbank, sie war bleich geworden und atmete schnell: „Oh, ich halte Sie schon“, sagte Doralice, „legen Sie den Arm auf meine Schulter, so wie man beim Tanzen den Arm auf die Schulter des Herrn legt – so. Es war doch ein wenig zu weit, Sie sind das nicht gewohnt.“
„Danke, gnädige Frau“, sagt Lolo und errötete, „jetzt ist mir besser, ich bin das Meer nicht gewohnt, und ich wollte dort immer im Blanken schwimmen, und das war ein wenig zu weit.“
Читать дальше