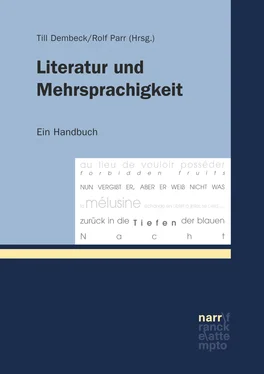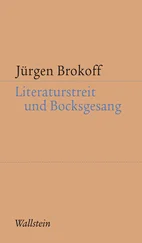Leonhardt, JürgenLeonhardt, Jürgen, Latein. Geschichte einer Weltsprache , München 2009.
Link, JürgenLink, Jürgen, »Literaturanalyse als Interdiskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik«, in: Jürgen FohrmannFohrmann, Jürgen/Harro MüllerMüller, Harro (Hrsg.), Diskurstheorien und Literaturwissenschaft , Frankfurt/M. 1988, S. 284–307.
Link, JürgenLink, Jürgen, »Zur Frage, was eine kulturwissenschaftliche Orientierung der Literaturdidaktik ›bringen‹ könnte«, in: kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie , 45/46 (Mai 2003), S. 71–78.
Linke, AngelikaLinke, Angelika, »Signifikante Muster – Perspektiven einer kulturanalytischen Linguistik«, in: Elisabeth Wåghäll NivreWåghäll Nivre, Elisabeth u.a. (Hrsg.), Begegnungen. Das VIII. Nordisch-Baltische Germanistentreffen in Sigtuna vom 11. bis zum 13.6.2009 , Stockholm 2011, S. 24–44.
Lotman, Jurij M.Lotman, Jurij M., »Zum kybernetischen Aspekt der Kultur«, in: Ders., Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur , hrsg. v. Karl EimermacherEimermacher, Karl, Kronberg, Ts. 1974, S. 417–422.
Luhmann, NiklasLuhmann, Niklas, »Kultur als historischer Begriff«, in: Ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik , Bd. 4, Frankfurt/M. 1995, S. 31–54.
Martyn, DavidMartyn, David, »Es gab keine Mehrsprachigkeit, bevor es nicht Einsprachigkeit gab: Ansätze zu einer Archäologie der Sprachigkeit (HerderHerder, Johann Gottfried, LutherLuther, Martin, TawadaTawada, Yoko)«, in: Till Dembeck/Georg MeinMein, Georg (Hrsg.), Philologie und Mehrsprachigkeit , Heidelberg 2014, S. 39–51.
Schank, Roger C.Schank, Roger C./Robert P. AbelsonAbelson, Robert P., Scripts, Plans, Goals and Understanding. An Inquiry into Human Knowledge , Hillsdale, N.J. 1977.
Stanitzek, GeorgStanitzek, Georg, »Was ist Kommunikation?«, in: Jürgen FohrmannFohrmann, Jürgen/Harro MüllerMüller, Harro (Hrsg.), Systemtheorie der Literatur , München 1996, S. 21–55.
Stockhammer, RobertStockhammer, Robert, Grammatik. Wissen und Macht in der Geschichte einer sprachlichen Institution , Frankfurt/M. 2014.
Trabant, JürgenTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken. Von PlatonPlaton bis WittgensteinWittgenstein, Ludwig , München 2006 [2003].
Tylor, Edward B.Tylor, Edward B., Religion in Primitive Culture , New York 1958 [1871].
2. Sprachliche und kulturelle Identität
Till Dembeck
Die sprachliche und damit auch kulturelle Bildung von Einheiten und ihre Konturierung durch Grenzziehung einerseits und die Subversion sprachlicher und kultureller Grenzen andererseits sind Grundoperationen von Literatur, deren Untersuchung unmittelbar Aufschluss über den kulturpolitischen Stellenwert von literarischer Mehrsprachigkeit verspricht. Diskutiert wird dies unter dem Schlagwort der Identität.
In die Kulturtheorie ist der Identitätsbegriff in erster Linie durch die Übertragung aus psychologischen Diskussionszusammenhängen eingegangen. Entscheidend ist hierbei die Auffassung, dass sich Identität nur durch Abgrenzung erzeugen lässt, so dass dem jeweils Ausgeschlossenen eine konstitutive Bedeutung für das Selbst zukommt. Diese Operation wird auch auf Gruppen bezogen und dann als Mechanismus der Konstruktion kultureller Identität bzw. Alterität beschrieben. BatesonBateson, Gregory spricht in diesem Zusammenhang von »Schismogenesis« (BatesonBateson, Gregory, »Culture Contact and Schismogenesis«). Die Zuschreibung von Andersartigkeit (›Othering‹) wird so zum Mechanismus der Stabilisierung von kultureller oder Gruppen-Identität.
Das wahrscheinlich wirkmächtigste Werkzeug zur Normierung und Kodifizierung von Einzelsprachen und damit zur Konstitution der Identität von Sprachen ist die Identifikation von Fehlern. Diese Operation ist unmittelbar mit Mechanismen der kulturellen Identitätsbildung verbunden. Sprachkompetenz ist in der europäischen Geschichte seit jeher Ausweis kultureller Zugehörigkeit. Mit Blick auf die Geschichte der Grammatik lässt sich behaupten: »Zur Grammatik gehört wesentlich eine Migrations- und Integrationspolitik« (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 318), die regelt, wer und was der jeweiligen Sprache zugehörig ist und wo demnach die Grenzen dieser Sprache zu anderen Idiomen verlaufen.
Gerade der Begriff der (Sprach-)Kompetenz verweist allerdings auch auf die Grenzen eines Begriffs von kultureller Identität, der auf der Operation der »Schismogenesis« aufbaut. Denn Sprachkompetenz muss in jedem Einzelfall als komplexes Gefüge von Fähigkeiten angesehen werden, die sich auf unterschiedliche Strukturebenen der Sprache und auf unterschiedliche Einzelsprachen beziehen können. Auch Kulturkompetenz umfasst im Einzelfall dann sehr divergente, nach Rollen und Gesellschaftsbereichen ausdifferenzierte Fertigkeiten. Daher wird im Folgenden vorgeschlagen, kulturelle Identitäten als je unterschiedlich definierte Bündel kultureller Fähigkeiten zu bestimmen, also als Bündel von Fähigkeiten, bedeutungsunterscheidende Differenzen erkennen und einsetzen zu können, insbesondere auch sprachliche.
b) Historische Semantiken sprachlicher und kultureller Identität
Der Geschichte des Kulturbegriffs ist von Beginn an eine Semantik der Gruppenidentität eingeschrieben. Die Wirkmächtigkeit von Unterscheidungen wie Hellenen/Barbaren, Christen/Heiden und Menschen/Unmenschen legt davon Zeugnis ab. Von Beginn an dienen dabei auch sprachliche Merkmale zur Identifikation von Gruppenzugehörigkeit. So besagt eine in der Antike und nachmals populäre Semantik des Begriffs ›Solözismus‹, er beziehe sich ursprünglich auf das durch Sprachmischung unsauber gewordene Griechisch der Anhänger des Solon im kilikischen Soloi (ReisiglReisigl, Martin, »Solözismus«, 960) – so dass der Solözismus als Fehler gilt, an dem man zumindest die Abschwächung der kulturellen Zugehörigkeit ablesen kann. Eine prominentere Parallelgeschichte hierzu findet sich im Buch der Richter (12, 5f.), das von der Ermordung der Ephraimiter erzählt, die man daran erkannte, dass sie das Wort ›Schibboleth‹ nur als ›Sibboleth‹ aussprechen konnten – wobei beide Varianten eigentlich als phonematisch identisch gelten (siehe DerridaDerrida, Jacques, Schibboleth , 59). Als ›Schibboleth‹ gilt noch heute jede lautliche Markierung kultureller Differenz.
Historisch betrachtet sind sehr unterschiedliche Kopplungen sprachlicher und kultureller Identitätsbildung zu beobachten. So ist es keineswegs zwingend, bereits dem antiken Griechenland die Konzeption von Sprache als Idiom, also als abgrenzbarer Einheit, zu unterstellen, so dass ein ›Solözismus‹ durchaus nicht notwendig kulturelle Fremdheit signalisiert, sondern eher eine territoriale Zugehörigkeit markiert. Dementsprechend offen zeigt sich AristotelesAristoteles für Abweichungen vom herrschenden Sprachgebrauch. ›Fremde‹, d.h., aus anderen dialektalen Zusammenhängen stammende Wörter, γλῶττα, werden analog zu Metaphern als Ergebnisse eines Übertragungsvorgangs angesehen (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 303–308).
Demgegenüber verleiht die Zweisprachigkeit des antiken Rom, die lange vor der Zeitenwende u.a. das Bedürfnis erzeugt, das Lateinische als Kultursprache aufzuwerten, der Kategorie der Sprachrichtigkeit eine neue Dimension (KrausKraus, Manfred, »Sprachrichtigkeit«, 1121). Anders als in der griechischen Antike kommt es daher spätestens im ersten Jahrhundert vor Christus zu einer Kodifizierung und Fixierung der Sprache (LeonhardtLeonhardt, Jürgen, Latein , 61–74) – und zugleich zu einem genaueren Bewusstsein für die Fremdheit anderer Idiome. Vergleicht bereits AristotelesAristoteles den Umgang mit Wörtern aus der Fremde mit Prozessen der Einbürgerung, so wird diese Metaphorik von Marcus Fabius QuintilianQuintilian, Marcus Fabius ausgebaut, der wörtlich von migrierenden Wörtern, verba peregrina, spricht (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 307f., 317–322). Im Detail wird nun diskutiert, wie fremde Wörter zu flektieren seien und inwiefern beispielsweise im Interesse der metrischen Form Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit, die latinitas, gerechtfertigt sein können. QuintilianQuintilian, Marcus Fabius, dessen Institutio Oratoria wirkmächtig die Vergleichbarkeit von (immer ›verfremdenden‹) rhetorischen Figuren und grammatischen Fehlern herausstellt (und im selben Atemzug durch die strikte Trennung von Rhetorik und Grammatik wieder zu kassieren sucht), bemüht sich ausführlich um eine Klassifizierung der Barbarismen, die sich im Übrigen als identisch erweist mit derjenigen, die er für Figuren der Rede vorsieht (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 313–316). Die Problematik der Unterscheidung von Figur und Fehler lässt so den Status des sprachlich Fremden selbst unsicher werden: die gute Rede ist auf fremde Strukturen angewiesen, obwohl diese zugleich die Einheit des Idioms gefährden.
Читать дальше