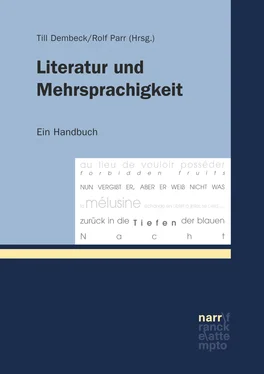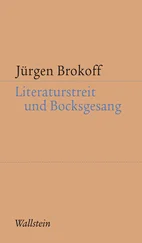Auch wenn moderne Beschreibungen von Kultur beider Richtungen in je unterschiedlicher Weise auf Sprache bezogen sind, misst die Systemlinguistik dem Faktor Kultur in der Regel einen nur marginalen Stellenwert zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Linguistik in der Nachfolge Ferdinand de SaussureSaussure, Ferdinand des (dem damit teilweise Unrecht getan wird) als erklärende und nicht als interpretierende Wissenschaft versteht. Damit aber fällt Kultur als zu interpretierender Sachverhalt aus ihrem Gegenstandsbereich heraus. Dem widerspricht aktuell der Vorschlag der kulturanalytischen Linguistik, die auf unterschiedlichen Ebenen der Sprachstruktur Verfahren der Mustererkennung beschreibt und mit kultur-, sozial- und medienhistorischen Kontexten in Verbindung bringt (vgl. LinkeLinke, Angelika, »Signifikante Muster«). Auch die Rezeption der Diskursanalyse Michel FoucaultFoucault, Michels durch die Linguistik führt teilweise zu einer Neuentdeckung von Kultur als Rahmenbedingung von Sprache, wenn auch in erster Linie (funktional ausdifferenzierte) Einzeldiskurse in den Blick geraten und gerade nicht das diffuse Bündel dessen, was anderenorts als Kultur beschrieben wird (vgl. KußeKuße, Holger, Kulturwissenschaftliche Linguistik ). Eine gewichtige Ausnahme bildet hier die Interdiskursanalyse, die sich für die Regularitäten von Aussageweisen interessiert, die in Spezial- wie auch verbindenden Interdiskursen anzutreffen sind. Im Mittelpunkt des Interesses stehen hier u.a. »[k]ulturspezifische synchrone Systeme von Kollektivsymbolen« (LinkLink, Jürgen, »Literaturanalyse als Interdiskursanalyse«, 297), die als diskursverbindende Elemente, d.h. als der kulturelle Kitt moderner Gesellschaften und ihrer ausdifferenzierten Spezialdiskurse fungieren (siehe für einen daraus zu entwickelnden Kulturbegriff LinkLink, Jürgen, »Zur Frage«).
Von den großen Theorievorschlägen aus dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat die soziologische Systemtheorie erstaunlich wenig zum Kulturbegriff beigetragen, zumindest nicht bei Niklas LuhmannLuhmann, Niklas selbst, der Kultur u.a. als semantisches Gedächtnis beschrieben hat (LuhmannLuhmann, Niklas, »Kultur als historischer Begriff«). In Dirk BaeckerBaecker, Dirks ausführlicher Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff wird Kultur demgegenüber als Korrelat einer (historischen) Praxis des Vergleichs beschrieben und sodann systematisch als eine Form der mitlaufenden Beobachtung bestimmt, die Doppelwertigkeit erzeugt und dazu in der Lage ist, gegenüber zweiwertigen Unterscheidungen dritte Alternativen einzubringen (BaeckerBaecker, Dirk, Wozu Kultur? ). Auf der Basis des systemtheoretischen Kommunikationsbegriffs und dessen philologischer Präzisierung (StanitzekStanitzek, Georg, »Was ist Kommunikation?«; BaßlerBaßler, Moritz, Die kulturpoetische Funktion ) ist schließlich vorgeschlagen worden, grundsätzlich davon auszugehen, dass Kommunikation, um sich als Rekursion (ereignishaft) entfalten zu können, auf vorgängige Kommunikation zurückgreifen können muss, die wiederum in quasi-textueller Form vorliegen muss (sei es im individuellen Gedächtnis von Menschen, sei es in Textform). Dabei erfolgt der Rückgriff letztlich durch die ›Entzifferung‹ von bedeutungsunterscheidenden Einheiten. Kultur ist systematisch an dieser Stelle zu verorten: Sie sorgt dafür, dass Kommunikation als Ereignis auf ihr quasi-textuelles Substrat zugreifen kann (vgl. Dembeck, »Reading Ornament«). Aus dieser Funktion von Kultur ergibt sich die Möglichkeit, sie (mindestens) in einer doppelten Perspektive wahrzunehmen: Einerseits ist der Vorrat von Semantiken, der Gesellschaft zur Verfügung steht, nicht denkbar, wenn keine bedeutungsunterscheidenden Merkmale ausgemacht werden können. Insofern hat Kultur unmittelbar etwas mit Textualität zu tun, auch wenn sie nicht mit Textualität gleichgesetzt werden kann. Denn Kultur besteht eben andererseits aus Mechanismen, die sich rekursiv erhalten, stabilisieren, aber auch verändern, wodurch der zutreffende Eindruck entsteht, dass Kultur an entscheidender Stelle an der Konstitution gesellschaftlicher Regeln Teil hat.
Für die Erforschung literarischer Mehrsprachigkeit ist diese Doppeldeutigkeit des Kulturbegriffs von besonderem Interesse: Als Kulturdifferenzen verweisen Sprachdifferenzen einerseits auf unterschiedliche etablierte Arten und Weisen der Interpretation gesellschaftlicher und anderer Strukturen und Prozesse. Andererseits aber sind Sprachdifferenzen immer auch Anzeichen von potentiellen Konflikten darüber, wie gesellschaftlich Signifikanz konstituiert werden soll. Sie haben in diesem Sinne ein kulturpolitisches Potential. Die Untersuchung von Sprachdifferenzen im literarischen Text erlaubt Rückschlüsse auf beides. Damit wird insbesondere die (kultur-)politische ›Agency‹ von Literatur beschreibbar. Das Interesse für kulturpolitisch engagierte Formen der Literaturwissenschaft (insbesondere mit postkolonialem Hintergrund) für Mehrsprachigkeit rührt wahrscheinlich auch daher.
Abelson, Robert P.Abelson, Robert P., »Script Processing in Attitude Formation and Decision Making«, in: John S. CarrollCarroll, John S./John W. PaynePayne, John W. (Hrsg.), Cognition and Social Behavior , Hillsdale, N.J. 1976, S. 33–67.
Anderson, BenedictAnderson, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism , London/New York 2006 [1983].
Arens, HansArens, Hans, Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart , Frankfurt/M. 1974 [1955].
Baecker, DirkBaecker, Dirk, Wozu Kultur? , Berlin 2003 [2000].
Baßler, MoritzBaßler, Moritz, Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine literaturwissenschaftliche Text-Kontext-Theorie , Tübingen 2005.
Berger, Peter L.Berger, Peter L./Thomas LuckmannLuckmann, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie , Frankfurt/M. 2007 [1966].
Bhabha, Homi K.Bhabha, Homi K., The Location of Culture , London 2000.
Bonfiglio, Thomas PaulBonfiglio, Thomas Paul, Mother Tongues and Nations. The Invention of the Native Speaker , New York 2010.
Borst, ArnoBorst, Arno, Der Turmbau zu Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker , München 1995 [1957–1963].
Bunia, RemigiusBunia, Remigius, Romantischer Rationalismus. Zu Wissenschaft, Politik und Religion bei NovalisNovalis (Friedrich Freiherr von Hardenberg) , Paderborn u.a. 2013.
Dembeck, Till, »Reading Ornament. Remarks on Philology and Culture«, in: Orbis Litterarum 68.5 (2013), S. 367–394.
Dembeck, Till, »X oder U? HerdersHerder, Johann Gottfried ›Interkulturalität‹«, in: Dieter HeimböckelHeimböckel, Dieter u.a. (Hrsg.), Zwischen Provokation und Usurpation. Interkulturalität als (un)vollendetes Projekt der Literatur- und Sprachwissenschaften , München 2010, S. 127–151.
Geertz, CliffordGeertz, Clifford, »Thick Description. Toward an Interpretive Theory of Culture«, in: Ders., The Interpretation of Cultures. Selected Essays , New York 1973, S. 3–30.
Grafton, AnthonyGrafton, Anthony, »The Humanist as Reader«, in: Guglielmo CavalloCavallo, Guglielmo/Roger ChartierChartier, Roger (Hrsg.), A History of Reading in the West , übers. v. Lydia G. CochraneCochrane, Lydia G., Amherst/Boston 1999 [1995], S. 179–212.
Koselleck, ReinhartKoselleck, Reinhart, »Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe«, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten , Frankfurt/M. 1989 [1975], S. 211–259.
Kuße, HolgerKuße, Holger, Kulturwissenschaftliche Linguistik. Eine Einführung , Göttingen 2012.
Читать дальше