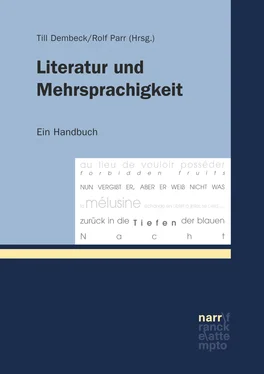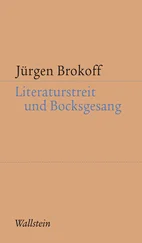Auch die wichtigsten Belegerzählungen der jüdischen und dann der christlichen Tradition für Fragen der Sprachdifferenz, die Babel- und die Pfingstwundererzählung, weisen Sprache als Anzeichen oder Instrument von Kultur aus. So hat der Bau des Turms zu Babel das Ziel, den Zusammenhalt der Menschheit zu sichern (Gen 11) – widerspricht damit aber dem göttlichen Willen, der mit der Besiedlung der Erde durch die Menschen offenbar auch die Zerstreuung ihrer Sprachen vorgesehen hat (Gen 1.26–28).1Borst, ArnoBorst, Arno Umgekehrt ist die Verheißung des Pfingstwunders auch eine der Aufhebung aller Sprachdifferenzen im und durch den christlichen Glauben.
Die im weitesten Sinne kulturelle Unterscheidung zwischen Christen und Heiden, die in vielerlei Hinsicht die ältere Differenz zwischen Hellenen und Barbaren beerbt (KoselleckKoselleck, Reinhart, »Zur historisch-politischen Semantik«, 229–244), hat so einerseits einen sprachtranszendierenden Impetus. Ein Beispiel dafür ist die Abwendung des Kirchenvaters AugustinusAugustinus von Hippo von der Kunst der Rhetorik. Augustinus spielt in PaulinischerPaulus von Tarsus Tradition das Wort Gottes gegen das menschliche, auf die Pluralität von Wörtern angewiesene Sprechen aus (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 83–91) und bereitet so die Verknüpfung christlicher Theologie mit einem sich auf AristotelesAristoteles rückbeziehenden Denken vor, das Gedanken bzw. Logik unabhängig von Sprache und damit auch von partikularen Kulturdifferenzen konzipiert (TrabantTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken , 25–34, 45–52). Andererseits entwickelt das Christentum – auch hier ist AugustinusAugustinus von Hippo eine prägende Kraft – in Fortschreibung antiker Rhetorik und Grammatik eine sehr konkrete und folgenreiche Sprachpolitik, denn es macht hochgradig kodifizierte ›heilige‹ Sprachen, vor allem das Lateinische und nur in Nebenrollen das Griechische und das Hebräische, zum zentralen Organon der kirchlichen Verwaltung des Seelenheils aller Menschen. Die u.a. von AugustinusAugustinus von Hippo ausgehende Aneignung und Umschrift der antiken Überlieferung durch das Christentum führt schließlich – vermittelt u.a. über die sog. karolingischeKarl der Große Bildungsreform, durch die das Lateinische überdies zur zentralen Verwaltungssprache avanciert – zur Sammlung des christlich fundierten Weltwissens in Systemen der hochmittelalterlichen Scholastik. Das scholastische Latein, in dem dieses System formuliert wird, avanciert zum zentralen Medium christlich-abendländischer Sprach- und Kulturpolitik (zu den Veränderungen, die es dabei durchläuft, siehe LeonhardtLeonhardt, Jürgen, Latein , 172–186).
Einen weiteren entscheidenden Schritt hin zu einem modernen Kulturbegriff leistet – ausgehend von der Zeit der karolingischenKarl der Große Reformen (LeonhardtLeonhardt, Jürgen, Latein , 140–148) – seit dem Hochmittelalter einerseits das zunehmende Erstarken der Volkssprachen, andererseits die humanistische Bewegung zur Wiederherstellung der antiken Quellen und des antiken Lateins. So erfolgt der Rückgriff auf möglichst originale Sprachzeugnisse des Griechischen wie des Lateinischen zumindest implizit – wie man am Ausufern der kommentierenden Vermittlung der Texte ablesen kann – vor dem Hintergrund eines neuen Bewusstseins für ihre Fremdheit (vgl. GraftonGrafton, Anthony, »The Humanist as Reader«). Der Humanismus ist so auch eine Bewegung zur Wiederaneignung einer fremdgewordenen (und zugleich in der Wiederaneignung in dieser Fremdheit affirmierten) Vergangenheit des kulturell Eigenen (vgl. TrabantTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken , 76–83). Das Erstarken der Volkssprachen wiederum kann einerseits als Emanzipationsbewegung verstanden werden. Dies signalisiert insbesondere die Semantik der Muttersprache, deren Beginn in Dante AlighieriDante Alighieris Schrift De vulgari eloquentia (1303–1305) zu sehen ist: DanteDante Alighieris Bemühungen gelten einer Sprache jenseits der grammatica, also jenseits des Lateinischen. Dabei wird der besondere Wert dieser Sprache damit in Verbindung gebracht, dass sie der Mensch ›natürlich‹ entwickelt, wohingegen Latein ›künstlich‹ gelehrt wird (BonfiglioBonfiglio, Thomas Paul, Mother Tongues and Nations , 72f.). Allerdings ist andererseits schon DanteDante Alighieris Schrift, die überdies für etwa zwei Jahrhunderte keine Anschlüsse findet, keineswegs darauf aus, die tatsächlich gesprochenen Volkssprachen zu nobilitieren; noch geht es um die Entwicklung einer Nationalsprache; vielmehr interessiert DanteDante Alighieri die Konstitution einer literarischen Hochsprache (TrabantTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken , 70–72). Auf die Volkssprache wird so der Anspruch der grammatica übertragen – wodurch aus ihr allerdings auch eine andere Sprache wird.
Eine wesentliche kultur- und sprachpolitische Konsequenz der neuen Muttersprachensemantik ist seit der Frühen Neuzeit gleichwohl die Identifizierung der zunehmend kodifizierten modernen Sprachen mit denjenigen Idiomen, die die jeweilige Nation ›von Natur aus‹ spricht. Anders formuliert: In Kontexten wie der italienischen Diskussion über die ›Questione della lingua‹ (TrabantTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken , 84–106), in der Entwicklung der ersten neusprachlichen Grammatiken, Wörterbücher und Orthographien wird zwar die grammatische Einheitlichkeit der jeweiligen Volkssprachen behauptet und sprachpolitisch etabliert (StockhammerStockhammer, Robert, Grammatik , 327–338), zugleich wird dieses Faktum aber ausgeblendet und zunehmend durch die Behauptung der natürlichen Einheit der nationalen Sprachen überdeckt. Am Ende dieser Entwicklung steht spätestens um 1800 die Auffassung, der Muttersprachler sei als Verkörperung ›seiner‹ Muttersprache aufzufassen, wie sie etwa bei Johann Gottfried HerderHerder, Johann Gottfried oder bei Jacob GrimmGrimm, Jacob zu finden ist (vgl. MartynMartyn, David, »Es gab keine Mehrsprachigkeit«). Die Volkssprachen haben in diesem Moment einerseits die Heiligen Sprachen beerbt, so dass es nur konsequent ist, wenn das Lateinische zum Ende des 18. Jahrhunderts plötzlich als ›tote Sprache‹ bezeichnet wird (LeonhardtLeonhardt, Jürgen, Latein , 6–16). Andererseits erhalten sie einen gänzlich neuen Status, denn in ihnen wird die grammatica als Quasi-Natur zum Garanten kultureller Einheit.
Diese Entwicklung betrifft aber nur einen Aspekt des sich in der Neuzeit formierenden Verhältnisses von Kultur- und Sprachbegriff. Komplementär, wenn auch in leichter Spannung zur Muttersprachensemantik, etabliert sich der moderne Kulturbegriff im 18. Jahrhundert als Korrelat einer neuartigen Praxis des Vergleichens (BaeckerBaecker, Dirk, Wozu Kultur , 44–57). Sie stellt die Selbstverständlichkeiten der sozialen Praxis und vor allem der gesellschaftlichen Erzeugung von Signifikanz grundsätzlich und systematisch in Frage und macht ihre Kontingenz sichtbar. Die Bereitschaft zur Einräumung von Kontingenz ist wahrscheinlich das eigentlich Moderne an diesem Kulturbegriff, der so betrachtet in erster Linie eine Verunsicherung mit sich bringt.
Gleichwohl steht diese Auffassung von Kultur in enger Relation zu derjenigen, dass die Muttersprache kulturelle Einheit garantiere. Beide werden teils von denselben Autoren vertreten, beispielsweise von HerderHerder, Johann Gottfried. Dessen epochemachende Arbeit zum Sprachursprung führt die Sprache des Menschen unmittelbar auf die Fähigkeit zurück, aus der Masse der Sinnesdaten wiederholt Merkmale herauszufiltern und sie damit als wiederholbare Zeichen zu konstituieren.2Herder, Johann GottfriedBollacher, MartinGaier, Ulrich Dabei legt HerderHerder, Johann Gottfried besonderen Wert darauf, diese Operation mit Blick auf die Sinnesdaten als kontingent auszuweisen: Die Dinge selbst legen nicht schon fest, was an ihnen für den Menschen zeichenhaft werden kann. Auf diese Weise erklärt sich für HerderHerder, Johann Gottfried auch, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arten und Weisen entwickelt haben, Sprachzeichen zu konstituieren, woraus er wiederum die kulturelle Vielfalt der Menschheit und auch die Spannungen und Konflikte zwischen den Völkern ableitet (vgl. Dembeck, »X oder U?«). Diese Vielfalt mit kontingenten Grundlagen kann dann ebenso Ausgangspunkt des modernen kulturellen Vergleichs werden, wie sie auch Anlass geben kann zu jener Wertschätzung kultureller Ursprünglichkeit, für die Herders Name einsteht, d.h., zur Wertschätzung von kultureller und sprachlicher Partikularität, die HerderHerder, Johann Gottfried und nach ihm beispielsweise Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm von gerade als Ausweis humanistischer Universalität gilt (TrabantTrabant, Jürgen, Europäisches Sprachdenken , 226–229, 260–267).
Читать дальше