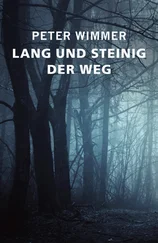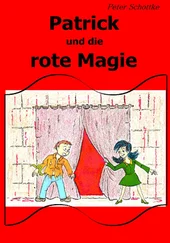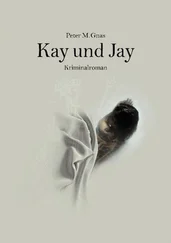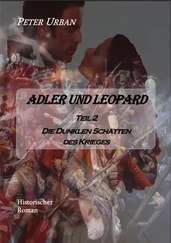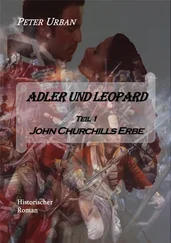Obwohl nicht bekannt ist, welche keltischen Stämme zur Zeit der römischen Eroberungen im Alpenvorland um die Zeitenwende westlich des Inns siedelten, während sich östlich des Inns das keltische Königreich Noricum befand, spricht nichts dafür, dass es die keltischen Boier gewesen wären. Hätte das heutige Nieder- und Oberbayern damals einen mit dem Namen der Boier verbundenen Gebietsnamen getragen oder wären dort die Boier beheimatet gewesen, so hätten ihn die Römer gewiss wie jenen des benachbarten Noricum übernommen, was jedoch nicht geschah. Auf die offenbar namenlose Gegend dehnten sie daher vom Bodensee her den Namen der Räter nach Nordosten bis zur Donau aus. Das keltische Boioduron/Passau war zweifellos ein unterhaltener südlicher Außenposten der Boier als Handelsort. Wenn seinen Namen die Römer fortsetzten, kann dies ebensowenig wie die Gravur von Manching als Beweis für ein einstiges „Boierland“ Bayern dienen.3 Während Rübekeils Erkenntnis, der germanische Baiernname gehört zu einer germanischen Namengruppe im germanisch/römischen Grenzland und bezeichnet germanische Wehrmänner, die das germanische Land vor Übergriffen der Römer schützen und verteidigen und die daher im germanischen Gebiet nördlich des Römerreiches und des Donaulimes beheimatet waren, weiterführt, geht Rübekeils Versuch, sich der Meinung der Archäologen anzuschließen, in die Irre.
1.5.5.3. Die Baiern in neuer historischer Sicht
Auffallend reserviert verhalten sich die Mittelalterhistoriker gegenüber den neuen Ansichten zur Identitätsbildung der Baiern. So nennt der Erlanger Frühmittelalterforscher Guido M. Berndt in seiner Besprechung des Sammelbandes „Die Anfänge Bayerns“ von Fehr/Heitmeier bloß die Themen der einzelnen Beiträge, wenn er hinsichtlich der Romanentheorie der Archäologen zur Herkunft der Baiern auch gewisse Auffassungsunterschiede zwischen ihren Vertretern Arno Rettner, Hubert Fehr und Jürgen Haberstroh erkennen möchte.1 Ausführlich befasst sich zwar der Wiener Mittelalterhistoriker Herwig Wolfram in seinem Rezensionsaufsatz „Die Anfänge Bayerns im Zwielicht“ mit einzelnen Beiträgen, geht aber mit keinem Wort weder auf die Romanentheorie der Archäologen noch auf die noch vorzustellende Norikertheorie der Historikerin Irmtraut Heitmeier ein. Dass für Wolfram aber der Name der Baiern mit den Boiern und Böhmen zu tun hat, wird deutlich an der mit brieflicher Unterstützung von Wolfgang Haubrichs (Saarbrücken) und Hermann Reichert (Wien) ausführlich dargelegten Analyse der Slawenbezeichnung Beovinidi in der „Historia Langobardorum Codicis Gothani“. Diese entstand 807/10 in Oberitalien im Zusammenhang mit dem Frankenkönig Pippin von Italien, nachdem dieser 806/07 die Mauren von Korsika vertrieben und zuvor 798 an einem verwüstenden Feldzug gegen die böhmischen Slawen teilgenommen hatte. In den gegen 860 abgeschlossenen sogenannten „Annales Xantenses“, die Gerward, der ehemalige Pfalzbibliothekar Ludwigs des Frommen in den Jahren 814-30, anlegte, werden sie Beuwinitha geschrieben. Dieses ist niederfränkisch und entspricht der Herkunft Gerwards vom Niederrhein oder aus Friesland, wo germ. ai zu ē monophthongiert und der stimmhafte Spirant germ. đ als th beibehalten wird. Das aber bestätigt das Erstglied des Baiernnamens germ. * Baiowarjōz , der in Verbindung mit den Beovinidi auf Böhmen bezogen werden kann und somit als Klammerform * Baio[haima]warjōz zu verstehen ist, so dass der Name der Baiern „ursprünglich tatsächlich ‚Leute aus Böhmen’ bedeutet“.2 Wenn die Schreibung Beovinidi auch im Codex Gothanus auftritt, so ist zu bedenken, dass er dem fränkischen Umkreis König Pippins angehört und in diesem Namen wohl auch dort fränkisches ē für germ. ai galt.3 Damit hält Wolfram an der von der Sprachwissenschaft vorgetragenen Erklärung des Baiernnamens fest und erteilt somit indirekt sowohl der Romanentheorie als auch der Norikertheorie eine Absage. Wenn ich recht sehe, haben die verschiedenen Beiträge von Arno Rettner und Hubert Fehr zur Herkunft der Baiern auch sonst bei Historikern kein Echo ausgelöst. Dafür beschreitet nun Irmtraut Heitmeier in ihrem umfänglichen Beitrag zum Sammelband „Die spätantiken Wurzeln der bairischen Noricum-Tradition“ als „Überlegungen zur Genese des Herzogtums“ völlig neue, kühne Wege.
Heitmeier betont, dass man hinsichtlich der Entstehung des Herzogtums und der Herkunft der Baiern immer nur aus gegenwärtiger Sicht Bayern und damit bezüglich der Frühzeit bloß die westliche Raetia secunda im Blick habe, jedoch das zugehörige, östlich gelegene Noricum ausblendet. Es gibt aber vom Frühmittelalter bis ins 12. Jh. eine Tradition, die Bayern mit Noricum in Zusammenhang bringt. Ihr geht Heitmeier nach, um daraus neue Einblicke sowohl in die Frage nach der Herkunft der Baiern als auch der Entstehung des Herzogtums zu gewinnen.
Schon um 790 erzählt Paulus Diaconus in seiner „Langobardengeschichte“ nach einer Quelle aus der Zeit um 600, dass der Langobardenkönig Authari nach heimlicher Brautschau „von den Grenzen der Noriker“ ( de Noricorum finibus ) nach Italien zurückgekehrt sei, und erklärt deren Gebiet folgendermaßen (III, 30):
Noricorum siquidem provincia, quam Baiovariorum populus inhabitat, habet ab oriente Pannoniam, ab occidente Suaviam, a meridie Italiam, ab aquilonis vero parte Danuvii fluenta
Die Provinz der Noriker freilich, die das Volk der Baiovaren bewohnt, grenzt im Osten an Pannonien, im Westen an Suavien, im Süden an Italien, im Norden aber an einen Teil des Donauflusses.
An jüngeren derartigen Gleichsetzungen von Baiern mit Noricum sei die gleichlautende Promulgation zweier Freisinger Traditionen von 825 und 846 genannt, die mit den Worten beginnt (Tr. Freis., Nr. 521, 678):
Notum cunctis fidelibus in Noricana provincia …
Bekannt gemacht sei allen Getreuen in der norischen Provinz …
Beide Traditionen betreffen Besitzübertragungen im Umkreis von Mainburg rund 25 km nördlich von Freising und somit mitten im Herzen Bayerns bzw. in der einstigen Raetia secunda.
Solche westliche Ausweitungen der Territorialbezeichnung Noricum überraschen, wenn man bedenkt, dass seit der mittleren römischen Kaiserzeit der Inn nicht nur die Provinzgrenze der Raetia secunda und von Noricum bildete, sondern zugleich auch Zollgrenze zwischen dem westlichen Gallischen und dem östlichen Illyrischen Zollbezirk war. Obwohl die Reichsteilung von 395 in eine Westhälfte mit Rom und eine Osthälfte mit Konstantinopel/Byzanz zeitweise aufgehoben wurde, wirkte die westliche Zuweisung der Raetia secunda zu Italien und die östliche von Noricum und Pannonien zu Konstantinopel/Byzanz dennoch nach. Sie kam 476 nach der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus August(ul)us insofern zum Tragen, als der oströmische Kaiser Zenon I. (476–491) sich nicht nur als Kaiser des Gesamtreiches betrachtete, sondern besonderes Interesse haben musste, an der Westflanke seines unmittelbar östlichen Herrschaftsbereiches in Noricum nach dem Zusammenbruch der weströmischen Herrschaft durch ständige Germaneneinfälle und dann durch den Abzug der romanischen Bevölkerung nach Italien wieder Ordnung und militärische Absicherung herzustellen. Wenn man bedenkt, dass sich die an der Reichsgrenze auftretenden Germanengruppen mit dem Grundwort - warjōz / - varii ‚Wehrmänner, Schützer, Verteidiger‘, nämlich ihres eigenen Grenzgebietes, bezeichnen und sich im Baiernnamen Baiowarjōz / Baiovarii das Erstglied auf Böhmen bezieht, dann lässt sich folgender Schluss ziehen.
Unter Berücksichtigung des militärischen Aspektes dieser Bezeichnung kann man annehmen, dass solche germanischen Verbände zur Verteidigung eines Gebietes eingesetzt wurden. Dabei mussten die germanischen Soldaten weder in das römische Heer eingegliedert werden, noch als Föderaten Aufnahme finden, sondern diese Gruppen übten in einem vertraglich festgelegten Gebiet selbst Befehlsgewalt aus, so dass sie faktisch im Besitz des Territoriums waren. Im Fall von Ufernoricum wäre vorstellbar, dass ein Teilverband der aus Böhmen abziehenden Elbgermanen, die später im Osten unter dem Namen der Langobarden in Mähren und dem östlichen Niederösterreich und dann in Pannonien reüssierten, sich nach Südwesten orientierte, die Donau überschritt und vom oströmischen Kaiser auf dem Reichsboden von Ufernoricum unter Vertrag genommen wurde, um diesen byzantinischen Grenzraum abzusichern. Damit aber war Ufernoricum fest in germanischer Hand und haftete der Name Baiowarjōz / Baiovarii somit auf dem Gebiet östlich des Inns, das heute das voralpine Ober-und Niederösterreich ausmacht. Als nach dem Tod der Gotin Amalasvintha 535 die Langobarden in Pannonien mit Byzanz im Osten und den expansiven fränkischen Merowingern im Westen politisch zusammenwirkten, behielten die Baiern in Ufernoricum die Oberhand, und der von den Franken eingesetzte neue Herzog „Garibald muss es gewesen sein, dem es gelang, die Gebiete westlich und östlich des Inns im Sinne des späteren bairischen Herzogtums zu verbinden“.4 Damit aber kam es, was Heitmeier nicht mehr weiter verfolgt, sichtlich auch zur Ausweitung des germanischen Baiernnamens vom stärkeren östlichen Gebietsteil auf den schwächeren westlichen, so dass mit der Raetia secunda ein bairisches Gesamtgebiet als neues Herzogtum entstand. Dabei wurde in Fortsetzung der antiken Namentradition das westliche Gebiet teilweise auch mit dem östlichen lateinischen Namen Noricum bezeichnet.5
Читать дальше