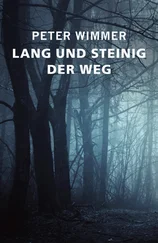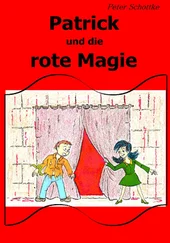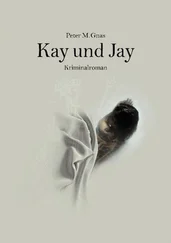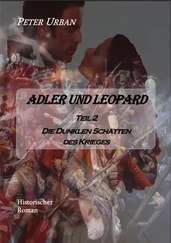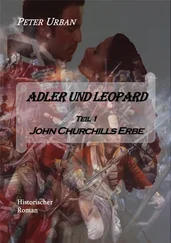Doch zurück zu Rettner, der in seinem Beitrag zum Sammelband von 2012 dann zwar einräumt, dass ab dem späten 5. Jh. mit verstärkter germanischer Zuwanderung in die Gebiete südlich der Donau zu rechnen ist,7 aber weiterhin an der Romanenthese festhält. Im Anhang korrigiert bzw. ergänzt Rettner auf Grund von Hinweisen und mehrfacher Kritik seine bisherigen Listen von Ortsnamen romanischer Herkunft und von romanisch-deutschen Mischnamen.
Auf dem von Rettner vorgezeichneten Weg schließen sich weitere Studien von Archäologen an. So beschäftigt sich 2012 der Münchener Archäologe Jürgen Haberstroh mit der Frage „Der Fall Friedenhain ‒ Přešt’ovice – ein Beitrag zur Ethnogenese der Baiovaren?“ Gerade diese an beiden Orten gefundene und übereinstimmende Feinkeramik schien ja die These einer Einwanderung zumindest eines Teiles der Baiern zu bestätigen. Sie wird aber nicht nur dadurch in Frage gestellt, dass diese Feinkeramik nur an wenigen südböhmischen Fundplätzen vorkommt, was die Einwanderung größerer Volksgruppen fraglich macht, sondern sie tritt in Variation sowohl im Barbaricum des 3.–6. Jhs. als auch überhaupt in ganz Süddeutschland auf und ist nicht an germanischen, sondern an römischen Mustern orientiert. Es lässt sich daher keinerlei Herkunftsthese an diese Feinkeramik knüpfen. Allerdings räumt Haberstroh ein, dass die Variationen sowohl im barbarischen als auch im römischen Gebiet auf Werkstattunterschiede zurückgehen. Dabei gelte es, einerseits die Spezifik der Keramik des Typus Přešt’ovice ‒ Friedenhain herauszuarbeiten und andererseits die Werkstattunterschiede im römischen wie im germanischen Gebiet festzustellen und gegeneinander abzugrenzen. Aber diesen langwierigen Untersuchungen scheinen sich die Archäologen gar nicht unterziehen zu müssen, denn die Einwanderungsthese der Baiern wird noch mit weiteren Argumenten abgelehnt.
Radikaler und polemischer verfährt der in Freiburg im Breisgau lehrende Archäologe Hubert Fehr. Er trug seine Kritik in dem ausführlichen Beitrag „Am Anfang war das Volk? Die Entstehung der bajuwarischen Identität als archäologisches und interdisziplinäres Problem“ auf der 2006 in Wien veranstalteten Internationalen Konferenz „Archäologie der Identität“ vor, deren Ergebnisse 2010 veröffentlicht wurden. Dabei löst der Terminus Identität bisheriges Ethnogenese und älteres Stammesbildung ab. Fehr sieht als Ausgangspunkt und Basis der bisherigen archäologischen Suche nach der Herkunft der Baiern die kaum jemals hinterfragte Annahme der Sprachwissenschaft, dass der Baiernname „Männer aus Böhmen“ bedeute und die Baiern daher aus Böhmen eingewandert seien. Das aber stellt Fehr von seinem positivistischen Standpunkt aus entschieden in Abrede, weil es dazu weder historische Nachrichten über eine germanische Einwanderung aus Böhmen in den Donauraum der Raetia secunda und von Noricum gebe, noch überhaupt über germanische Einwanderungen in ehemals römisches Gebiet. Mangels derartiger schriftlicher Quellen besitzen daher einzig und allein die archäologischen Funde als materielle Zeugnisse Quellenwert, so dass nur aus ihnen verbindliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Aber der bislang angestellte Nachweis bairischer Einwanderung mit Hilfe der Keramik vom Typus Přešt’ovice ‒ Friedenhain versagt insofern, als es einerseits bloß geringe innerböhmische Fundplätze gibt und andererseits diesseits und jenseits des römischen Limes unterschiedliche Begräbnissitten gepflegt wurden. Während nämlich nördlich germanische Brandbestattung üblich war, herrschte auf römischem Boden seit der Mitte des 5. Jhs. Körperbestattung in Reihengräbern. Sie aber waren keine mitgebrachte Sitte, sondern eine Neuerung. Ebensowenig sind die Beigaben von Waffen und Fibeln ein bairisches Charakteristikum, sondern sie waren in weit größerem Umfang verbreitet und begegnen auch in alemannischen Reihengräbern in Württemberg und am Rhein sowie im westfränkischen Nordgallien. Deshalb dürfen sie nicht als Indiz für nördliche germanische Zuwanderung nach Bayern bewertet werden, sondern sind vielmehr als Angleichung an fränkisch-merowingische Bestattungssitten zu verstehen.8 Überhaupt möchte Fehr die Entstehung einer bairischen Identität im Anschluss an die obgenannte positivistische Ansicht des Historikers Jörg Jarnut erst im Zusammenhang mit der Bildung eines bairischen Herzogtums und der Einsetzung der Agilolfinger als Herzöge nach 536/37 sehen, nachdem 535 die Gotenregentin Amalasvintha ermordet worden war. Das aber korrespondiert mit der Erstnennung der Baiern in den historischen Quellen um 550/60. Somit betrachtet Fehr in seinem Beitrag „Friedhöfe der frühen Merowingerzeit in Baiern – Belege für die Einwanderung der Baiovaren und anderer Gemeinschaften?“ von 2012 die Einwanderungsthese polemisch als „Meistererzählung“, um nicht zu sagen als ein hübsch erfundenes Märchen.9
Zusammenfassend steht für die Archäologen trotz Unterschieden im Einzelnen viererlei fest:
Eine schon lange postulierte Einwanderung der Baiern aus Böhmen in den bairischen Raum der Raetia secunda und von Noricum beruht auf der sprachwissenschaftlichen Interpretation des Baiernnamens als „Männer aus Böhmen“; doch gibt es weder für eine solche Einwanderung noch überhaupt für Einwanderungen von Germanen in ehemals römische Gebiete schriftliche Zeugnisse.
Auch archäologisch lässt sich keine Einwanderung von Germanen aus Böhmen wie überhaupt aus Gebieten nördlich der Donau nachweisen, denn der dafür besonders herangezogene Beweis einer Feinkeramik des Typus Přešt’ovice ‒ Friedenhain stellt kein bairisches Charakteristikum dar und kommt seit dem 5. Jh. auch in weiteren merowingischen Gebieten vor, wenn es auch Werkstattunterschiede gibt. Ferner zeigen die als weiterer Beweis herangezogenen Beigabensitten in ihrer Verbreitung diesseits und jenseits des römischen Limes deutliche Unterschiede.10
Der Neustamm der Baiern hat sich erst nach dem Tod der Gotenregentin Amalasvintha 535 und dem zerfallenden Gotenreich mit der Einsetzung des den fränkischen Merowingern nahestehenden Herzogs Garibald gebildet, wobei zeitliche Korrespondenz mit dem Auftreten des Baiernnamens seit 551 besteht.
Die Entstehung des Neustammes der Baiern vollzog sich auf ehemals provinzialrömischem Gebiet südlich des Donaulimes mit der dort ansässigen romanischen Bevölkerung, was sich aus den dort auftretenden Ortsnamen romanischer Herkunft und aus den Mischnamen mit einem romanischen Personennamen ergibt.
Es liegt auf der Hand, dass diese teilweise mit Absolutheitsanspruch vorgetragenen Konzepte der Archäologie fachbegrenzt und daher einseitig sind, obwohl die anstehenden Fragen nur interdisziplinär gelöst werden können. So wird aus der Sicht der Sprachwissenschaft nicht gefragt, wie ohne angebliche germanische Zuwanderung und ohne Beteiligung einer ein germanisches Idiom sprechenden Bevölkerung sich dann ein Sprachwechsel vom Romanischen zum Germanischen vollzogen hat, wie die antik-romanischen Gewässer- und Ortsnamen in das sich entwickelnde Althochdeutsche integriert worden sind und wie sich romanisch-deutsche Mischnamen gebildet haben.
1.5.3. Die schon früher vorgetragene, doch widerlegte „Romanentheorie“ über die Herkunft der Baiern
Die besonders vom Archäologen Arno Rettner favorisierte Ansicht einer bairischen Ethnogenese bzw. Identitätsbildung auf provinzialrömischem Boden der Raetia secunda unter maßgeblicher Beteiligung der ansässigen romanischen Bevölkerung kann man als „Romanentheorie“ bezeichnen. Sie ist keineswegs neu, und ihr Vortrag vor mehr als 35 Jahren wurde von der germanistischen Sprachwissenschaft längst überzeugend widerlegt und zurückgewiesen. Dennoch muss sie vor allem im Hinblick auf eine zur Unterstützung herangezogene neue, gerade aus der Germanistik kommende, doch andere Intentionen verfolgende Studie von Wolfgang Haubrichs zu den vom 8. bis 10. Jh. aus dem bairischen Sprachraum überlieferten romanischen und biblischen Personennamen und mit solchen gebildeten deutschen Ortsnamen als romanisch-deutsche Mischnamen eingegangen werden.
Читать дальше