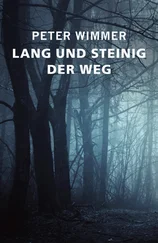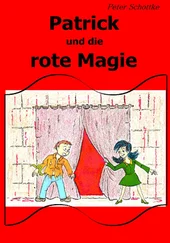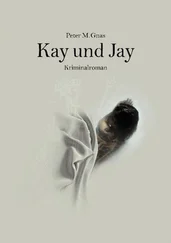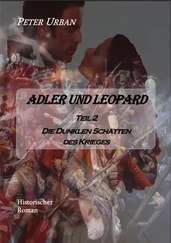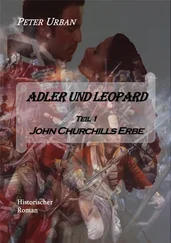Im Hinblick auf die bairische Ethnogenese ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht jedenfalls festzuhalten, dass das Bairische elbgermanisch geprägt ist. Daraus ist zu folgern, dass der prägende Bevölkerungsanteil aus Elbgermanen bestand und daher gegenüber den anderen beteiligten Germanengruppen und den Restromanen den überwiegenden Teil ausgemacht haben muss. Wahrscheinlich war er wesentlich höher als jene gerade 60 %, die sich aus den obgenannten vermuteten Anteilen von ca. 25 % Alemannen, 25 % Langobarden und 10 % Thüringern ergeben, sonst hätte sich das Elbgermanische nicht zum Bairischen entwickelt und durchgesetzt.
1.5. Herkunft und Identitätsbildung der Baiern in neuer Sicht
1.5.1. Die Situation
Da in der Forschung wissenschaftliche Erkenntnisse und Standpunkte stets hinterfragt werden und vor allem eine nachrückende jüngere Generation gegenüber ihren Vorgängern nach trefflicheren Einsichten strebt, ja seit den gesellschaftlichen Umbrüchen von 1968 auch in der Wissenschaft Traditionen bewusst abgebrochen und neue Gegenpositionen aufgebaut werden, ist das dargestellte Bild von Herkunft, Name und Ethnogenese der Baiern nach der Jahrtausendwende sukzessive, besonders aber von Archäologen, doch teilweise auch von Historikern und Sprachwissenschaftlern abgebaut worden. Den neuen, noch heterogenen Forschungsstand von über 20 Jahren nach der Baiernausstellung von 1988 versuchen der Freiburger Archäologe Hubert Fehr und die Münchener Historikerin Irmtraut Heitmeier auf der Basis einer 2010 in Benediktbeuern veranstalteten Tagung in dem 2012 erschienenen umfänglichen Sammelband „Die Anfänge Bayerns“ mit dem spezifizierenden Untertitel „Von Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria“ darzustellen. Das nach wie vor große Interesse an diesen Fragen bewirkte 2014 dessen 2. Auflage. Die meisten neuen Thesen, die keinen Stein auf dem anderen lassen, wurden aber schon vorher vorgetragen.
1.5.2. Die Ansichten der Archäologen
Die Neuansätze eröffnete 2002 der Münchener Archäologe Arno Rettner mit seiner noch zurückhaltenden, doch deutlich fragenden Studie „402, 431, 476 – und dann?“ mit dem Untertitel „Archäologische Hinweise zum Fortleben romanischer Bevölkerung im frühmittelalterlichen Südbayern“. Neue Gräberfunde des 5. Jhs. einer sicher povinzialrömischen Bevölkerung ‒ kurz Romanen genannt ‒ führten dazu, bisher angenommene Anhaltspunkte für einen Rückzug von Romanen zeitlich immer mehr hinaufzuschieben. Damit bezog man sich freilich zunächst auf die Reduktion des römischen Militärs und der Verwaltung, indem man mit Truppenabzug 401/02 unter Stilicho und nach den Juthungenkämpfen des Aetius 429/31 rechnete, während man mit dem Ende des weströmischen Reiches 476 und damit dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft überhaupt einen großen Weggang der Romanen annahm. Rettner aber zeigt, dass in den neu entdeckten Gräberfeldern von St. Ulrich und Afra in Augsburg, am Lorenzberg in Epfach am Lech – beide im alemannisch-schwäbischen Gebiet – sowie im bairischen Altenerding die romanische Bestattungsweise mit geringen Beigaben dominiert und germanisches Totenbrauchtum mit Waffenbeigaben bei Männern und etwa mit Amulettgehängen und als „Vierfibeltracht“ bei Frauen stark zurücktreten oder überhaupt fehlen. So stellt sich die Frage, ob es angemessen ist, von „Restromanen“ angesichts der Ethnogenese der Baiern zu reden.
Bereits zwei Jahre später 2004 trug Arno Rettner seine neuen Ansichten über die Ethnogenese der Baiern unter dem provokanten Titel „Bauaria romana“ als „Neues zu den Anfängen Bayerns aus archäologischer und namenkundlicher Sicht“ vor und stellte damit die geltenden Ansichten auf beiden Gebieten in Frage. Archäologisch konstatiert Rettner in den Reihengräbern starke Unterschiede in Grabbeigaben im bayerischen Donauraum nördlich und südlich des römischen Limes in der Merowingerzeit besonders nach dem Tod Severins 482 und dem Rückzug der Romanen nach Italien 488 in Noricum. So fehlt etwa in Männergräbern südlich der Donau die nördliche Mitbestattung von Reitzubehör und Pferden und in Frauengräbern vielfach die nördliche Beigabe von Webschwertern, und in beiden Fällen sind Speisebeigaben im Süden geringer als im Norden. Daraus wird die unterschiedliche Nachwirkung romanischer bzw. germanischer Bestattungssitten und damit das Bestehen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, vor allem ein hoher fortbestehender Anteil an Romanen im ehemals römischen Gebiet der Raetia secunda, gefolgert. Deshalb sucht Rettner nach weiteren Argumenten für romanische Kontinuitäten der Baiern in ihrem Siedlungsraum südlich der Donau. Dazu zieht er, obwohl kein Sprachwissenschaftler, die eingedeutschten Ortsnamen romanischer Herkunft als tradierte echte antik-romanische Bildungen und als romanisch-deutsche Mischnamen, das sind neue deutsche Bildungen mit romanischen Personennamen, heran. Bei Letzteren wird angenommen, dass die anfängliche Bewohnerschaft romanisch war und auch romanisch sprach und sich schließlich das deutsche Idiom der hinzugetretenen und zunehmenden deutschen Bewohnerschaft durchsetzte. Da Rettner dabei auf verschiedene ältere Arbeiten zurückgreift, nennt er auch solche Ortsnamen, für die eine früher versuchte romanische Etymologie sich nicht mehr halten lässt. Ebenso bedient sich Rettner der noch zu besprechenden, in den 1980er Jahren vom Klagenfurter Allgemeinen Sprachwissenschaftler und Romanisten Willi Mayerthaler vorgetragenen These, wonach das Bairische eine Kreolsprache mit romanischer Grundlage und germanisierter alemannischer Überformung sei, ohne aber die von der Germanistik bereits damals vorgetragene Kritik und Widerlegungen auch nur mit einem Wort zu erwähnen. So werden für Rettner die Baiern des 6. Jhs. zu „einer romanisch-germanischen Mischbevölkerung zwischen Alpen und Donau, die sich eben durch dieses Spezifikum … von den benachbarten Alamannen, Langobarden oder Franken abhob“.1
Mit der Zurückweisung der anhand der Keramik des Typus Přešt’ovice ‒ Friedenhain aufgezeigten archäologischen Zusammenhänge von Südböhmen und Bayern bezweifelt Rettner schließlich auch die germanische Etymologie des Baiernnamens und sucht nach einer romanischen. Er glaubt, sie in lautähnlichem lat. baiulare ‚Lasten tragen, schleppen‘ und lat. baiulus ‚Lastenträger‘ gefunden zu haben, und versteht die Baiern als Lastenträger von Waren aus Italien über die Alpen durch Bayern nach Germanien, wobei das anfängliche inlautende - l - dann verloren gegangen sei. Den Anlass zu dieser Etymologie bietet Rettner die Vita Severini, 29, 18ff., wo es heißt2:
… conductis plurimis comitibus, qui collo suo vestes captivis et pauperibus profuturas, quas Noricorum religiosa collatio profligaverat, baiularent .
Er hatte viele Kameraden geworben, die auf ihrem Nacken Kleidungsstücke schleppten , welche für Gefangene und Arme bestimmt und durch fromme Sammlung der Noriker aufgebracht worden waren.
Eine wohl als Nachdruck verleihende hinzugefügte jüngere bildliche Wiedergabe dieser Legende mit warenschleppenden Baiuli ‚Lastenträgern‘ findet sich auf dem Predellenbild des Polyptichons aus der Kirche SS. Severino e Sossio in Neapel von 1470 des Meisters von San Severino, das jetzt im Schloss Berchtesgaden aufbewahrt wird.
Zu seiner romanischen Etymologie befragte Rettner eine Anzahl germanistischer Sprachwissenschaftler, die jedoch eine solche lautgesetzlich nicht mögliche Bildung mit Recht ablehnte.3 So müsste im 5./6. Jh. eine romanische Entlehnung im Nominativ Plural germ. * Baiolowarjā und lat. * Baiolovarii bzw. mit Assimilierung * Baioloarjā bzw. * Baioloarii lauten, denn ein inlautendes - l - schwindet einfach nicht. Dagegen hält der Altphilologe und verdiente bayerische Namenforscher Wolf-Armin Frhr. von Reitzenstein in seiner Behandlung von diesbezüglichen Volksetymologien „Neue Etymologien des Baiern-Namens“ von 2005/06 eine romanische Herkunft des Baiernnamens für wahrscheinlich und bietet, angeregt durch Rettners Etymologie, eine daran anknüpfende eigene Version.4 Dabei geht er von der lateinischen Lesart Baibari bei Jordanes aus, die er unter den überlieferten Varianten für die ursprüngliche gotische Form des Namens hält, und sieht im Erstglied dieses Kompositums lat. baium ‚Last‘5 und im Zweitglied germ. bar von bëran ‚tragen‘ wie z.B. in ahd. eimbar ‚Eimer‘ als Lehnwort aus lat. amphora , das seinerseits aus gr. ἀμφορέος entlehnt ist und lat. ferō / gr. φέρω ‚tragen‘ enthält. Die ‚Lastträger‘ bedeutende Volksbezeichnung, die nichts mit den Boiern und Boi(o)haemum zu tun habe, sei als rom./germ. Mischbildung im Kauderwelsch des römischen Heeres mit Angehörigen aus vielen Sprachen entstanden und könnte anfänglich eine Spottbezeichnung gewesen sein. Bei romanischer Weiterentwicklung zu Baivari sei das Zweitglied dann wegen lautlicher Ähnlichkeit mit germ. * warja ‚Bewohner‘ zusammengefallen und so der überlieferte Baiernname entstanden. Auch diese Herleitung, die den Anschauungen der Archäologen folgt und den Zusammenhang des Baiernnamens mit den Boii und Boi(o)haemum beseitigen möchte, ist wie die anderen von Reitzenstein behandelten neuen Etymologien des Baiernnamens eine volksetymologische Konstruktion, die Bestandteile aus verschiedenen Sprachen miteinander verbindet und von deren Teilen wieder einen durch ein anderes Wort ersetzt, angebliche Vorgänge, die nicht nur im Ablauf unrealistisch erscheinen, sondern wofür es auch in der Lehnwortforschung keine Entsprechungen gibt. Außerdem widerspricht diese Konstruktion lautgesetzlichen Entwicklungen. Ein gotisches * Baiwarjos und ein spätwestgerm. * Baiwarjā des 5./6. Jhs. würde in der 2. Hälfte des 8. Jhs. zu bair.-ahd. * Bēore mit Monophthongierung von ai vor w zu ē führen. Reitzenstein hält an seiner nicht möglichen Etymologie weiterhin fest und wiederholt sie 2014 und 2017.6
Читать дальше