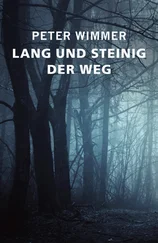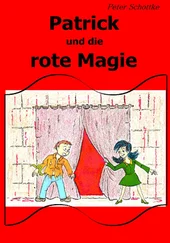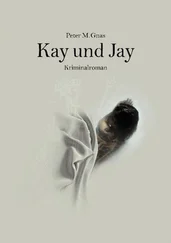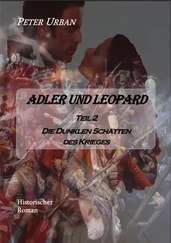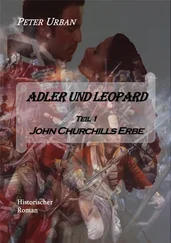Schon 1971 trug der Münchener Historiker Karl Bosl in seiner „Geschichte Bayerns“ die bis zur 7. und letzten Auflage 1990 unverändert beibehaltene „Romanentheorie“ zur Herkunft der Baiern vor.1 Danach gehen die Baiern auf die bodenständigen Keltoromanen zurück, die seit der Mitte des 6. Jhs. nach der Konstituierung des Neustammes der Baiern von Franken und Alemannen germanisiert wurden.2 Diese These unterstützten in den 1980er Jahren der Salzburger Slawist Otto Kronsteiner und der Klagenfurter Allgemeine Sprachwissenschaftler und Romanist Willi Mayerthaler in einer Reihe von Studien. Nachdem Kronsteiner 1981 an die Universität Salzburg berufen worden war, veröffentlichte er zunächst in Zeitungsartikeln die These, der Name der Baiern gehe als romanische Bildung auf den antik-romanischen Namen Ivaro der Salzach zurück, und die Stadt Salzburg sei der Mittelpunkt des Entstehungsraumes der Baiern gewesen, so dass der Stammesname der Baiern als Gaubezeichnung romanisch * Pago Ivaro gelautet habe, der über * Pagivaro bald zu * Paiovaro kontrahiert worden sei. Erst 1984, nachdem bereits auf Tagungen die Diskussion darüber aufgenommen worden war, äußerte sich Kronsteiner mit „Der altladinische PAG(O)IVARO als Kernzelle der bairischen Ethnogenese“ in einem wissenschaftlichen Organ dazu. Seiner Auffassung schloss sich 1983/84 Mayerthaler mit seinem ausholenden Beitrag „Woher stammt der Name der ‚Baiern‘?“ an.3 Außerdem erklärte Mayerthaler das Bairische zu einer romanisch-germanischen Kreolsprache, einer Mischsprache auf romanischer Grundlage mit germanisch-alemannischer Überformung, deren romanische Elemente bis in die gegenwärtigen Dialekte weiterbestünden und deutlich greifbar wären. Beide Protagonisten verteidigten ihre Theorien mit Vehemenz, Polemiken und Angriffen auf die Methodik der germanistischen Sprachwissenschaft, doch wurden ihre Auffassungen mehrfach widerlegt, was hier alles nicht näher ausgeführt werden muss. Von Entgegnungen seien u.a. besonders angeführt Ingo Reiffenstein 1986 „Baiern und der Pagus Iobaocensium“ und 1987 „Stammesbildung und Sprachgeschichte“ sowie 1987 Hellmut Rosenfeld „ Die Völkernamen Baiern und Böhmen, die althochdeutsche Lautverschiebung und W. Mayerthalers These ‚Baiern = Salzburger Rätoromanen‘“. Bereits 1981 hatten Ludwig Eichinger und Robert Hinderling mit „Die Herkunft der Baiern im Lichte der Ortsnamen“ Karl Bosls „Romanentheorie“ eine Absage erteilt. Trotzdem lieferten Eva und Willi Mayerthaler verspätet 1990 in gleichem Sinn die Studie „Aspects of Bavarian Syntax or ‚Every Language Has at Least Two Parents‘“ nach. Lange unbeachtet findet sie jüngst im Zusammenhang mit der erneut von Arno Rettner vorgetragenen „Romanentheorie“ Beachtung durch den Leiter des Bayerischen Wörterbuches in München, Anthony Rowley, in seiner widerlegenden Auseinandersetzung „Bavaria germanica oder Romania submersa“ von 2017.4 Darin zeigt Rowley, dass Mayerthalers These, die Syntax des Bairischen sei völlig romanisch geprägt, sich nicht aufrecht erhalten lässt, denn die weit über ein Dutzend angesprochenen syntaktischen Phänomene weisen im Deutschen eine weit über das Bairische hinausgehende Verbreitung auf und sind unabhängig voneinander sowohl im Romanischen wie im Germanischen polygenetisch entstanden, was das Bairische fälschlich als ein germanisches Idiom auf quasi romanischer Basis erscheinen lasse.
Es ist daher von der „Romanentheorie“, wonach die Baiern germanisierte Romanen und das Bairische auf romanischer Sprachbasis entstanden sei und von Anfang an entsprechende romanische Strukturen und Substrate aufweise, zur Gänze abzulassen.5
1.5.4. Romanische und biblische Personennamen im bairischen Raum
Wenn seitens der Archäologie die „Romanentheorie“ erneut aufgegriffen wird, so spielt dabei besonders für Hubert Fehr die Abhandlung des Saarbrücker germanistischen Sprachwissenschaftlers Wolfgang Haubrichs „Baiern, Romanen und andere“ als „Sprachen, Namen, Gruppen südlich der Donau und in den östlichen Alpen während des frühen Mittelalters“ von 2006 eine maßgebliche Rolle, noch dazu wo im Titel Baiern und Romanen gemeinsam exponiert aufscheinen. Aber nichts liegt Haubrichs ferner, als eine romanische Herkunft der Baiern anzunehmen. Vielmehr arbeitet er sehr deutlich und unmissverständlich heraus, dass Bairisch, Alemannisch, Langobardisch und, soweit man dies aus den wenigen überlieferten Personennamen erschließen kann, auch das Thüringische elbgermanischer Herkunft mit vielen sprachlichen Gemeinsamkeiten sind. Innerhalb dieses elbgermanischen Sprachverbandes, der nach den Anfangsbuchstaben als BLA(T) -Gruppe zusammengefasst werden kann, aber weist gerade das althochdeutsche Bairische in gewissen Wortschatzbereichen wie etwa dem Rechtswortschatz Eigenständigkeit auf und unterscheidet sich so vom engverwandten althochdeutschen Alemannischen.
Dennoch ist es Haubrichs ein besonderes Anliegen, anhand der klösterlichen Quellen des 8.–10. Jhs. die überlieferten romanischen und biblischen Personennamen und die mit ihnen gebildeten Ortsnamen zusammenzustellen und auf das Miteinander von Romanen und Baiern in der frühmittelalterlichen Zeit nachdrücklich hinzuweisen. Dabei kann Haubrichs auf seine Erkenntnisse in den westmitteldeutschen Kontakträumen von Romanen und Franken insbesondere in Lothringen und im Moselland zurückgreifen. Am Namenmaterial des bairischen Raumes zeigt sich, dass die romanischen Personennamen die romanischen Lautentwicklungen des 6./7. Jhs. aufweisen wie im Konsonantismus die intervokalische Inlautlenierung von lat. t – p – k zu stimmhaftem d – v – g , z.B. Senator > Senadur , Lupo > Luvo , Jacobo > Jago(b ), und die Palatalisierung von - ti - / - di - vor Vokal zu < z , ci > / [- tßi -/- dsi -], z.B. Antiocho > Anciogo , Constantio > Custanzo , Laurentia > Laurenza , Claudia > Clauza , sowie im Vokalismus die Monophthongierung von au > o , z.B. Aurelian(o) > Orilan , Paulo > Polo .
Umgekehrt weisen romanische Personennamen bairisch-althochdeutsche Lautentwicklungen des 8. Jhs. auf. So vollziehen sie etwa im Konsonantismus die jüngeren Akte der Zweiten Lautverschiebung von rom. d – b – g zu bair.-ahd. t – p – k mit, z.B. Duro > Turo , Indo > Into , Beronician(o) > Peronzan , Habentio > Hapizo , Gaio > Keio , und im Vokalismus den i -Umlaut von a > e vor i oder Palatalkonsonanten der Folgesilbe, z.B. David > Tevid , Daniel > Tenil , Aletio > Elizo , Tapetio > Tepizo , und die Assimilierung von ai > ei , z.B. Maiol(o) > Meiol , Maioran(o) > Meioran , Gaio > Keio .1 Gerade hier aber fragt sich, ob angesichts solcher bairisch-althochdeutscher Lautentwicklungen Träger solcher romanischer Personennamen noch als echte Romanen und damit auch als Sprecher des Romanischen betrachtet werden können, oder ob sie sprachlich mit ihren bereits bairisch lautenden Namen romanischer Herkunft nicht schon zum Bairisch-Althochdeutschen übergegangen sind. Eine verbindliche Entscheidung lässt sich diesbezüglich nicht treffen, und Haubrichs ist vorsichtig genug, dies auch klar zu verstehen zu geben.
Ähnlich liegen die Probleme bei den mit einem romanischen PN und einem deutschen Grundwort oder einer deutschen Ableitung gebildeten Ortsnamen, den sogenannten „Mischnamen“, wie z.B. Marzling bei Freising mit Marcello (804-07 Marzilinga ) und mit Vidal < Vitalis gebildetem Figlsdorf bei Nagelstadt (850 Fitalesdorf ). Stillschweigend wird hier angenommen, dass die Träger romanischer Personennamen automatisch auch Sprecher des Romanischen waren und solche Ortsnamen bei Hervorhebung des romanischen Elements trotz deutscher Bildung als „romanische Ortsnamen“ betrachtet werden. Trotz erst jüngerer urkundlicher Erstüberlieferungen kann zwar bei einigen Mischnamen anhand lautlicher Merkmale eine frühe Bildungszeit festgestellt werden, aber es bleibt dabei offen, ob der Personenname damals noch romanisch war oder, wie die Personennamenüberlieferungen zeigen, bereits ins Bairisch-Althochdeutsche integriert war. Diese Problematik erhöht sich, wenn statt „Mischname“ in neuerer Terminologie von „Hybridname“ bzw. „Hybridbildung“ gesprochen wird. Hier wird nämlich vorausgesetzt, dass zunächst eine genuine romanische Namenbildung vorliegt, die dann später deutsch überformt wurde, so dass die überlieferten deutschen Ortsnamen nicht primäre Bildungen, sondern erst sekundäre, eben hybride Neubildungen sind. Es mag solche Fälle gegeben haben. So lässt z.B. der Name Abersee für den Wolfgangsee in Oberösterreich mit dem rom. Personennamen Abriano in seiner ältesten lateinischen Überlieferung von 788 Abriani lacum vermuten, dass dieser lateinischen Form eine romanische Form zugrunde liegt, aber bereits 829 heißt der See in integrierter Weise bair.-ahd. Aparinesseo . Trotz der lateinischen Kontexte weisen jedoch die Überlieferungen der Mischnamen seit dem 8. Jh. eindeutig bairisch-althochdeutsche Bildungen auf, z.B. Aising (Stadtteil von Rosenheim) 778/83 Agusing mit dem PN Agusius und Königsdorf bei Bad Tölz 776-88 Chumitzdorf mit dem PN Comitius .
Читать дальше