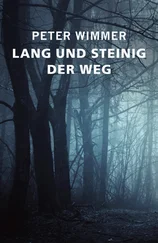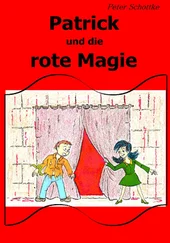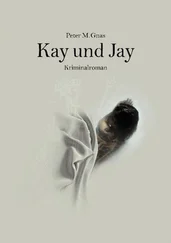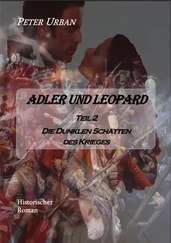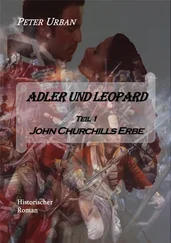Auf ein bei Mischnamen bis jetzt nicht beachtetes Problem macht Albrecht Greule aufmerksam. Bei den einfach als „romanisch“ bezeichneten Personennamen handelt es sich nämlich zum größeren Teil um biblische Namen und um Heiligennamen (Hagionyme), wobei die Romanen (im Gegensatz zu den Baiern) von Anfang an getaufte Christen waren. In solchen Fällen könnten zumindest einzelne Personennamen nicht unmittelbar auf „Romanische Ortsgründer“ als deren Träger zurückgehen, sondern auch auf Kapellen oder kleine Kirchen, die solchen Heiligen geweiht waren. Eine solche Möglichkeit könnte z.B. die Orte Jailing , Jaibling , Jasberg , † Jausberg mit Jacobus als Apostelname oder die zahlreichen Orte mit Irs -/ Irsch - betreffen, denen Ursus zugrunde liegt, wobei der hl. Ursus ein Angehöriger der Thebaischen Legion war und um 303 in Solothurn in der Schweiz das Martyrium erlitt. Auch ein Namenwechsel von einem germanischen zu einem biblischen oder Heiligennamen wäre möglich, denn im christlichen Irland und England erhielten des öfteren Geistliche neue solche Namen, ein Brauch, den irische und angelsächsische Missionare des 7. und 8. Jhs. mitgebracht haben könnten. Nach solchen umbenannten Geistlichen und Mönchen könnten diesen oder ihrem Kloster gehörende Orte mit Mischnamen benannt worden sein. Immerhin tragen von den 50 im bairischen Raum hier behandelten Mischnamen nicht weniger als 31 biblische Namen oder Heiligennamen, was nicht weniger als 62 % ausmacht.
1.5.5. Neueste Theorien zur Herkunft der Baiern und der Bedeutung ihres Namens
Vor allem die Neuansätze der Archäologen zur Klärung von Herkunft und Name der Baiern veranlassten auch die germanische Altertumskunde und die auffallend zurückhaltenden Historiker sich mit den neu aufgeworfenen Meinungen jeweils aus ihrer Sicht zu befassen. Es sind dies der Zürcher Altgermanist und germanische Altertumsforscher Ludwig Rübekeil und die Münchener Historikerin Irmtraut Heitmeier.
1.5.5.1. Die Baiern aus Sicht der gegenwärtigen germanischen Altertumskunde
Nicht im Hinblick auf die Herkunft der Baiern, sondern die sprachliche Bildung des auch diesen Namen betreffenden germanischen Namentypus und seine Bedeutung untersuchte Ludwig Rübekeil 2002 in seinem Buch „Diachrone Studien zur Kontaktzone zwischen Kelten und Germanen“. Es ist der schon oben erläuterte Namentypus germ. *- warjōz / lat. - varii ‚Wehrmänner, wehrhafte Mannschaft, Schützer, Verteidiger‘. Überliefert wird eine Reihe solcher Namen für germanische Gruppen vom 1. bis zum Beginn des 8. Jhs. von römischen Schriftstellern und in frühmittelalterlichen Quellen, wobei Velleius Paterculus und Tacitus am Beginn stehen. Die meisten dieser als Komposita gebildeten Namen weisen als Bestimmungswörter einen Landschafts-, Fluss- oder Ortsnamen auf wie Am(p)sivarii (Tacitus, Annalen 13, 55 u.ö.) den Flussnamen Ems , lat. Amisia (Tacitus, Annalen 1, 6 u.ö.), die zwischen Rhein und Ems siedeln, wo zur Zeit Kaiser Justinians im 6. Jh. Stephanos Byzantios noch eine gleichnamige Stadt Ἂμισ(σ)α kennt; oder Angrivarii (Tacitus, Germania 33; Annalen 2, 8) mit germ. * angraz in altsächs. und ahd. angar ‚Grasland, Wiese, Anger‘, wonach die Landschaft Engern beiderseits der Weser in Westfalen benannt ist. Wie diese beiden Namen so betreffen auch alle weiteren Namen Germanengruppen in Grenzgebieten gegen die Römer von den Angrivaren am Rhein im Westen bis zu den Baioaren an der Donau im Osten, wobei sie im Westen gehäuft auftreten und frühe Verteidiger der germanischen Gebiete gegen die expansiven Römer waren, die schon um die Zeitenwende versuchten, die Gebiete östlich des Rheins zu erobern und die Weser zur Nordostgrenze ihres Imperiums zu machen.
Für die Baioarii ergibt sich in diesen Zusammenhängen überzeugend ebenfalls ein Landschaftsname als Bestimmungswort.1 Er entspricht, wie gleichfalls schon oben ausgeführt, dem von Tacitus überlieferten Landschaftsnamen lat. Boi(o)haemum / germ. * Bai(o)haima , der im Stammesnamen durchaus zu Baia verkürzt sein kann, denn nur in diesem Sinn reiht sich dieser in die germanische Gruppe der - varii -Namen ein. Bezüglich der Bedeutung liegt auf der Hand, dass sich das Bestimmungswort nicht auf Böhmen in seinem heutigen Umfang beziehen kann, denn die germanischen Namenträger können dort angesichts der Entfernung von der Donau als römischer Grenze keine Verteidiger ihres Landes gegen die Römer gewesen sein. Als Lösung bietet sich für Rübekeil an, dass der Landschaftsname vom böhmischen Kerngebiet bis gegen die Donau insbesondere nach Westen bis gegen die Raetia secunda ausgedehnt war, so dass die Bewohner der Gebiete nördlich der Donau „Wehrmänner“ gegen die Römer sein konnten. Man kann dann weiters annehmen, dass nach dem Zusammenbruch der Römerherrschaft der Name mit dem verstärkten Eindringen der Germanen aus dem Vorland über die Donau in die ehemaligen römischen Provinzgebiete sich schließlich dort etablierte und zum Namen des Neustammes der Baiern wurde.
1.5.5.2. War Bayern ein ursprüngliches „Boierland?“
Unter dem Einfluss der mit Nachdruck vorgetragenen Thesen der Archäologen, die Baiern seien aus ansässigen Romanen der Raetia secunda hervorgegangen und auch ihr Name habe, wie Arno Rettner linguistisch allerdings unhaltbar meint, eine lateinische Grundlage, versucht nun Ludwig Rübekeil in seinem Beitrag „Der Name Boiovarii und seine typologische Nachbarschaft“ zum Sammelband von 2012 sich soweit wie möglich den Ansichten der Archäologen anzuschließen. Was er als germanistischer Sprachwissenschaftler freilich nicht aufgeben kann und unverändert beibehält, ist die lautgesetzlich unumstößliche germanische Etymologie des Baiernnamens. So setzt Rübekeil nun beim Bestimmungswort des Kompositums an und räumt ein, dass damit auch wie im Ausnahmefall der Chattuarii ein Einwohnername gemeint sein könnte. In diesem Sinn rechnet er nun gemeinsam mit den Archäologen damit, dass bei der Identitätsbildung der Baiern im ehemals provinzialrömischen Raum der Raetia secunda südlich der Donau als Bestimmungswort von Baioarii unmittelbar der Name der Boier herangezogen wurde. Als Grundlage dafür gelten ihm die Namen der Römerkastelle Boiodurum und Boitro in Passau sowie ein in Manching bei Ingolstadt überliefertes boios , das er als Personenname auffasst.
Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der heutige nieder- und oberbayerische Raum der Raetia secunda jemals mit dem Namen der Boier verbunden war, wofür es auch keine unmittelbaren Zeugnisse gibt. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die angezogenen Römerorte an der Peripherie sowohl des Römerreiches von Süden aus als auch vom Boierland Böhmen von Norden her lagen. Die Halbinsel von Passau, gebildet von Inn und Donau mit der von Norden in die Donau mündenden Ilz, war seit der Mitte des 5. Jhs. v.Chr. von Kelten besiedelt und ein Kreuzungspunkt der Handelswege in alle vier Himmelsrichtungen, die sich in römischer Zeit fortsetzten. Auf ihr lag ein keltisches Oppidum, dessen Name Ptolomaios um die Mitte des 2. Jhs. v.Chr. als Βοιόδουρον bezeugt und dessen Name dann die Römer nach dem Itinerarium Antonini als Boiodurum auf das von ihnen am Ende des 1. Jhs. n.Chr. auf dem rechten Innufer errichtete Kastell und einen sich anschließenden Vicus übertrugen und das bis ins 3. Jh. bestand, ehe es zerstört wurde.1 Während der Ort für die Kelten wohl ein Handelszentrum war und Brückenfunktion für den Warentransport hauptsächlich vom Süden in das Landesinnere in Böhmen im Norden hatte, diente das Kastell den Römern zur Bewachung und Sicherung der Limesstraße an der Donau gegen die Germanen. Die Notitia dignitatum überliefert dann für die 2. Hälfte des 3. Jhs. neben Batavis /Passau ein neuerrichtetes kleines Kastell Boiodoro stromaufwärts ebenfalls am rechten Innufer. Die Vita Severini von 511 nennt es dann Boi(o)-tro , und in seinen Mauern hatte Severin um 470 ein kleines Kloster errichtet. Sein Name lebt im Ortsnamen Beiderwies und im dort vorbei fließenden Beiderwiesbach weiter. Was das auf einem Scherben einer bauchigen Flasche aus dem keltischen Oppidum von Manching bei Ingolststadt des 1. Jhs. v.Chr. eingravierte boios betrifft, so ist es mehrdeutig und nicht, wie Rübekeil annimmt, als Personenname gesichert.2
Читать дальше