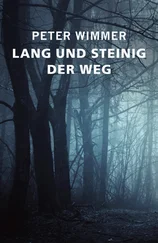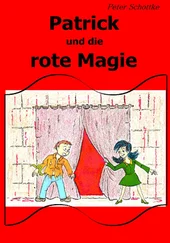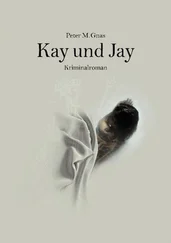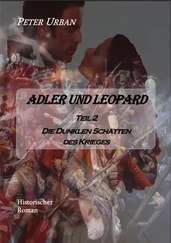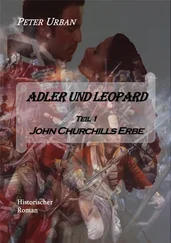Gegenüber diesen Auffassungen lassen sich jedoch anhand ihres Lautstandes 3 - ing -Namen im westlichen Niederösterreich wegen ihres, durch das - i- des Suffixes ausgelösten Primärumlautes von a zu e näher datieren. Sie müssen bereits vor der 2. Hälfte des 8. Jhs. entstanden sein, denn in dieser Zeit war der Primärumlaut wirksam. Es handelt sich um folgende Orte:
Empfing , Dorf, Gem. Stephanshart, PB Amstetten
D: 'empfiŋ
U: 1260-86 Emphinge , 1368 Empfing , 1411 Empfing in Steffensharter pharr
E: Mit dem bair.-ahd. PN Ampho
L: Wiesinger (1985), S. 355; Ernst (1989), S. 143; Schuster I (1989), S. 581.
Sölling , Dorf, Gem. Purgstall a. d. Erlauf, PB Scheibbs
D: 'söliŋ
U: 1108-16 predium … Selingin dictum , 1375 Sêling , 1392 Soling , 1402 S ling
E: Mit bair.-ahd. PN Salo 11
L: Wiesinger (1985), S. 355; Ernst (1989), S. 180; Schuster III (1994), S. 2911.
Hösing , Weiler, Gem. Hürm, PB Melk
D: 'hēsiŋ
U: 1319 Hesyng in Chulber pharr , 1425 Hossing ; 1430, 1455 Hesing
E: Mit dem bair.-ahd. PN Haso
L: Wiesinger (1985), S. 355; Ernst (1989), S. 156; Schuster II (1990), S. 308.12
Da in Niederösterreich Baiern aus dem Westen vorgedrungen sind, besteht bei Orten mit - ing -Namen auch die Möglichkeit der Namenübertragung aus dem Altsiedelland. Das wäre hier nur möglich bei Empfing als Dorf bei Traunstein, Oberbayern (1178-82 Otto filius Ottonis de Amphingen , 12. JhII Otto de Emphingen )13 sowie bei Sölling als Dorf in Büchlberg nördlich Passau, und als Einzelhof bei Waldkirchen, Lkr. Freyung-Grafenau, Niederbayern (1308 Vlreich von Selling , 1310 Jacob der Amman von Selling ),14 Selling als Weiler von Cham, Oberpfalz (ca. 1180 Hiltebrandus de Sellingen , 12. JhII Hilprandi de Sellingen , 1393 zu Selling ), Sölling als Zerstreute Häuser bei Steinerkirchen a. d. Traun, PB Wels-Land, Oberösterreich (1299 Selling , 1467 Seelling ) und bei Sölling als Weiler von Oberlebing bei Allerheiligen i. Mühlkreis, PB Perg, Oberösterreich (13. JhE datz Seling ; 1421, 1512, 1559 Selling ). Da aber das niederösterreichische Sölling unmittelbar an der Erlauf gegenüber von Zehnbach und Empfing vor dem Kollmitzberg liegt, ist angesichts von deren früher bair.-ahd. Integrierung autochthone Entstehung und Benennung dieser beiden Orte sehr wahrscheinlich. Hösing , das keine Entsprechung im Altsiedelland hat, liegt westlich der Pielach, die ursprünglich Loich hieß, und damit ebenfalls in der Nähe eines früh aufgegriffenen Flussnamens. Somit legen diese drei Orte nahe, dass es spätestens vor der Mitte des 8. Jhs. in Niederösterreich neben zahlreichen slawischen Siedlungen zumindest vereinzelt auch bairisch-deutsche Niederlassungen gab und nicht nur Gewässernamen frühe bairische Zeugnisse darstellen.
Die Annahme von Irmtraut Heitmeier, die Identitätsbildung der Baiern sei im ausgehenden 5. Jh. als militärische Schutztruppe unter oströmisch-byzantinischer Oberhoheit in Noricum von einer elbgermanischen, von den südostwärts ziehenden Langobarden sich abspaltenden Gruppe ausgegangen, kann also aus der Sicht der Namenkunde anhand der Gegebenheiten in Niederösterreich Unterstützung erfahren. Umgekehrt könnte mit Hilfe einer solchen von den Langobarden abzweigenden elbgermanischen Gruppe die frühe Integrierung lautverschobener antiker und einiger anderer Gewässernamen erklärt werden, denn auch bei den Langobarden gibt es die älteren Akte der Zweiten Lautverschiebung, die bei germ. t seit ihrem Auftreten in Italien am ausgeprägtesten vorhanden ist.15 Einer solchen neuen Auffassung von der Ethnogenese der Baiern schließt sich jedoch nicht die weitere Geschichtswissenschaft (Herwig Wolfram) und auch nicht die Archäologie an. Letztere kann weiterhin keinerlei langobardisch geprägte Funde im niederösterreichischen Donauraum westlich des Wienerwaldes, von Einzelstücken bei St. Pölten und Krems abgesehen, feststellen. Solche treten vielmehr zahlreich im Osten nördlich der Donau im Weinviertel und Marchfeld und südlich des Flusses im Umkreis der Leitha und im nördlichen Burgenland auf, wo sich ja die Langobarden um 500 niedergelassen hatten, ehe sie nach Pannonien weiterzogen.16
1.6. Zusammenfassung des neueren Forschungsstandes
Der aktuelle Forschungsstand zur Herkunft und zum Namen der Baiern seitens der daran beteiligten Disziplinen der Archäologie, der Sprachwissenschaft und der Geschichtswissenschaft bietet ein heterogenes Bild, wobei man vor allem eine gegenseitige Berücksichtigung der Fachmeinungen und eine echte Diskussion vermisst. Dabei wird das in den 1970-80er Jahren erzielte, weitgehend übereinstimmende Bild, wie es 1988 die Baiernausstellung in Mattsee und Rosenheim zusammenfassend darlegte, großteils, wenn auch nicht von allen Disziplinen und ihren einzelnen Forschern, in Frage gestellt und werden neue Ansichten vorgetragen. Im Einzelnen ist festzuhalten:
Die Archäologie stellt eine Einwanderung elbgermanischer Gruppen in die Raetia secunda, das heutige Bayern, was in erster Linie anhand des übereinstimmenden Keramiktypus von Přešt’ovice – Friedenhain nachzuweisen versucht worden war, völlig in Frage, weil diese Keramik, wenn auch in Variation überall verbreitet sei. Während man damals in den Reihengräbern zu beiden Seiten des Limes trotz nördlicher Brandbestattung und südlicher Körperbestattung Übereinstimmungen in den Beigabensitten erkannte, wird nun die Verschiedenheit hervorgehoben.
Daraus wird nun seitens der Archäologie der Schluss gezogen, die Identitätsbildung der Baiern – der neue Terminus statt bisherigem Ethnogenese – sei auf dem römischen Boden der Raetia secunda durch die bodenständige romanische Bevölkerung und ohne zugewanderte germanische Gruppen von jenseits des Limes erfolgt, wofür es auch keinerlei schriftliche Zeugnisse gibt. Die Frage, wieso sich dann nicht das Romanische etabliert, sondern die germanisch-deutsche Sprache durchgesetzt hat, wird weder gestellt noch erwogen.
Eine Bestätigung dieser „Romanentheorie“ von der Herkunft der Baiern sieht die Archäologie einerseits in der Tradierung und Integrierung antik-romanischer Gewässer- und insbesondere Siedlungsnamen in der Raetia secunda und andererseits in den auf das Fortleben von Romanen verweisenden deutschen Walchen - und Parschalken -Namen als auch in den zahlreichen deutsch gebildeten Mischnamen mit einem romanischen Personennamen und einer deutschen Ableitung oder häufiger als Kompositum mit einem deutschen Grundwort.
Seitens eines Teils der Vertreter der Namenkunde wird dargelegt, dass vor allem im voralpinen Raum der Raetia secunda des heutigen Ober- und Niederbayerns im Gegensatz zu Ufernoricum des heutigen Ober- und Niederösterreichs, von der Umgebung Salzburgs abgesehen, die Romanen über das Ende des weströmischen Reiches 476 hinaus zahlreich weiterlebten, was aus den vom 8.–10. Jh. überlieferten romanischen Personennamen gefolgert wird, wenn sich an diesen auch zunehmend bair.-ahd. Lauterscheinungen als Ausdruck ihrer Integrierung abzeichnen. Das lässt allerdings bezweifeln, ob die Träger solcher angepasster Personennamen romanischer Herkunft noch wirklich Romanen waren und romanisch sprachen.
Beides – archäologische Beurteilungen sowie tradierte antik-romanische Gewässer- und Siedlungsnamen und romanische Personennamen – führt dazu, dass seitens der Archäologie und im Anschluss vereinzelt auch von einem Namenforscher versucht wird, den Namen der Baiern aus dem Romanischen abzuleiten. Das aber scheitert an der Nichtberücksichtigung der von der germanistischen Sprachwissenschaft längst erkannten gesetzlichen und nicht willkürlichen Wortbildung und ebensolchen Lautentwicklungen, so dass sich derartige konstruierte Herleitungen als unwissenschaftliche Volksetymologien erweisen.
Читать дальше