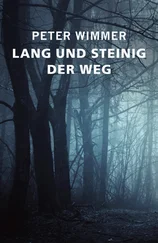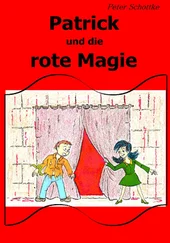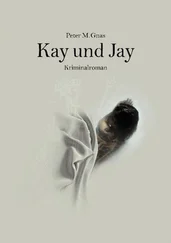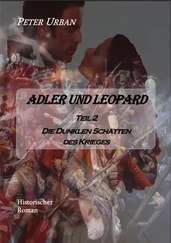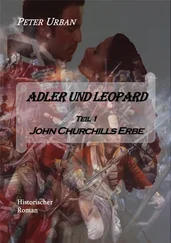Dieser zweifellos spekulative kombinierende Gedankenbau wird wahrscheinlich bei positivistisch ausgerichteten, vorwiegend mit überlieferten Fakten arbeitenden Historikern wenig Anklang finden. Trotzdem lässt sich eine solch mögliche östliche Herkunft der Baiern aus Ufernoricum, die man als Norikertheorie bezeichnen kann, mit namenkundlichen Argumenten stützen, die Heitmeier jedoch nicht in Betracht zieht. Sie betrifft Niederösterreich und damit das östliche Gebiet von Ufernoricum östlich der Enns, während Oberösterreich westlich dieses Flusses und der Salzburger Flachgau allgemein als altbairisches Land gelten.
Im niederösterreichischen Alpenvorland zwischen dem Wienerwald im Osten als alter Grenze von Noricum und Pannonien und der Enns im Westen, die sich um 700 als Grenze der westlichen deutschen Baiern gegenüber den im Osten auf Grund der Herkunft der Ortsnamen dominierenden Slawen herausgebildet hat, gibt es sowohl Gewässernamen antik-romanischer Herkunft, deren Integrierung ins Bair.-Ahd. mit den frühen, bis längstens 650 wirksamen älteren Akten der Zweiten Lautverschiebung erfolgt ist, was bei den integrierten Gewässer- und Ortsnamen slawischer Herkunft gänzlich fehlt, als auch solche Gewässernamen, deren Lauterscheinungen ebenfalls ohne slawische Vermittlung unmittelbar ins Bair.-Ahd. übernommen und weiterentwickelt worden sind. Ohne dass dies hier näher ausgeführt werden kann, handelt es sich bei der ersten Gruppe um die folgenden antik-romanischen Gewässernamen6:
Erlauf , rechter Nebenfluss der Donau bei Pöchlarn
D: ' ɒlɒf
U: antik Arlape , classis Arlapensis , fälschlich Arelate ; 832, 853 Erlafa / Erlaffa , 979 Erlaffa .
E: Die antike Benennung Arlapa ist ein Kompositum mit dem im deutschen Süden seltenen Grundwort idg. * apā ‚Wasser‘ und als Bestimmungswort einer Ableitung von idg. * er -/ or - (uridg. * h 3 er -)7 ‚in Bewegung setzen‘ in gr. ὄρνυμι ‚antreiben, losstürzen‘ als l -Ableitung * or-lo /- lā (uridg. * h 3 r - lo , fem. * h 3 r - lā ) ‚losstürzend‘, so dass der GewN „losstürzendes Wasser“ bedeutet. Wie es zu bair.-ahd. Ërlaffa mit bair.-ahd. ë kam, ist bisher nicht überzeugend geklärt worden, hängt jedenfalls nicht mit bair.-ahd. erila ‚Erle‘ mit Primärumlauts- e zusammen.8
Zehnbach , sehr kleines rechtes Seitenbächlein und Ort südlich von Pöggstall am Oberlauf der Erlauf
D: 'dsenֽbǭx
U: 1363, 1367, 1375 Zenpach
E: Bair.-ahd. * Zennepah wird zurückgeführt auf lat./rom. * Tania , wohl idg.-vspr. * Tan ā zu idg. * tā -/ tǝ - (uridg. * teh 2-, Präsens * t- -h 2- ‚benetze, tauche etwas ein‘).9
Loich , rechter Seitenbach am Oberlauf der Pielach und Ort
D: lōįx
U: 1307, 1317 Levch ; 1380, 1419, 1432 Leuch .
E: Ursprünglich wohl der keltische Name der dann slaw. benannten Pielach (831 Belaa , 811 Bielaha , 1072 Pielaha , 1130 Piela ; slaw. Běla ‚die Weiße‘) als lat./rom. * Leuca , kelt. * Leukā (vgl. gr. λευκός ‚weiß‘).
Zur zweiten Gruppe gehören:
Url , großer linker Nebenfluss der Ybbs bei Amstetten und kleiner rechter bei Waidhofen
D: 'ūɒ-l
U: 863 Hurulam ; 903, 906 Urulam ; 984, 10. JhII, 1094-1100 Urula
E: Bair.-ahd. Urula aus lat./rom. * Urla wird einerseits auf Grund des gekrümmten Laufes erklärt als idg.-vspr. * Urlā (vgl. osk. uruvú ‚Krümmung, Biegung‘, lat. urvum ‚gekrümmte Pflugschar‘) und andererseits gestellt zu uridg. * h 2 er - ‚feucht sein‘ jeweils mit - l -Erweiterung. Integriert als bair.-ahd. Urula mit anlautendem U - und Stützvokal - u -, was bei slaw. Vermittlung * Wurula aus slaw. * Vъr(ъ)la und heute * Wurl ergeben hätte.
Traisen , rechter Nebenfluss der Donau bei Traismauer
D: drǭɒsn
U: antik Tragisam(um) ; 828 Dreisma , 895 Treismae , 10. JhII Traisma .
E: Kelt. * Tragisamā mit kelt. trag - zu uridg. d h re /g h- ‚schleppen, ziehen‘ (vgl. gall. vertragus ‚schnellfüßiger Hund‘) als s -Stamm * trages - und Superlativsuffix *-is-ṃmā im Sinne von „sehr schnell fließender Fluss“ mit rom. Kontraktion von - agi - zu - ai -, das bei slaw. Vermittlung durch - a - substituiert worden wäre und heute * Trasen ergeben würde.
Ferner kann hier trotz seiner nicht eindeutigen Integrierung der Bergname Kollmitzberg angeschlossen werden:
? Kollmitzberg , von Westen her weithin sichtbarer Berg rechts an der Donau bei Amstetten, der sich rund 200 m über die Ebene erhebt.
D: ' khōįmɒs ֽ bęɒg
U: 1135 Chalmunze , 1151 Chalmŏnze
E: Lat./rom. * Calamontia , wohl idg.-vspr. * Kalamont ā mit idg. * kel -/ kol - (uridg. * kelH- ) ‚aufragen, hochragen‘ und * m -t -/ m ni o - ‚Berg, Gebirge‘ im Sinne von „hoch aufragender Berg“, was dem Erscheinungsbild entspricht. Wenn die Lautfolge - tia bereits assibiliert war, so erfolgte bei früher spätgerm. Übernahme Substituierung von [ tsa ] durch [ ta ] und dann frühe Zweite Lautverschiebung zu - z -. Im Zweitglied wurde - o - vor - nt - zu - u - gehoben und dann in der 2. Hälfte des 8. Jhs. zu [ ü ] umgelautet und anlautendes K - zu Ch - lautverschoben.
Was mögliche frühe bair.-ahd. Siedlungsnamen betrifft,10 gelten die - ing - und die - heim -Namen als die ältesten, auch stark verbreiteten Bildungstypen. Während sich die - heim -Namen, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, auf den oberösterreichischen Raum beschränken, sind die - ing -Namen im niederösterreichischen Alpenvorland bis um Wien im Osten stark verbreitet. Werden die - ing -Namen als „Pioniernamen“ betrachtet, indem von den darin genannten Personen angenommen wird, dass sie mit ihren Leuten den Grund und Boden in Besitz nahmen, so werden die - heim -Namen als jünger angesehen, indem sie bereits den Ansitz und damit eine gewisse Beheimatung im Neuland ausdrücken.
Unter diesen Aspekten stellte sich in der Forschung um 1980 die Frage, wie die divergenten Ansichten einer bairischen Besiedlung Niederösterreichs seitens der Geschichtswissenschaft, der Archäologie und der Sprachwissenschaft in Einklang gebracht werden können. Vor allem die Archäologie rechnete wegen einer bairischen Fundleere im 6. und 7. Jh. mit einer sukzessiven bairischen Besiedlung erst ab 976, als die Markgrafschaft Österreich der Babenberger errichtet worden war. Dem aber widersprachen die Ergebnisse der Sprachwissenschaft mit der Integrierung der Gewässernamen mit den ältesten Akten der Lautverschiebung bis spätestens gegen 650 und weiterer Integrierungen, auch von Gewässer- und Ortsnamen slawischer Herkunft in der 2. Hälfte des 8. Jhs. und im 9. Jh. So wurde ein Kompromiss dahingehend gefunden, dass schon spätestens seit dem 7. Jh. frühe bairische Verkehrskontakte in den Osten bestanden, zumal die Ennsgrenze gegen die Slavia sich erst um 700 ausbildete, was nicht nur frühe, sondern auch spätere Integrierungen von Gewässernamen ermöglichte, zumal Gewässer mit ihrem festen Verlauf Orientierungshilfen in der Landschaft boten und dies besonders im 7. Jh. bei geringer Besiedlung. Eine breite bairische Besiedlung setzte erst ab 976 ein, die im rund letzten Dreivierteljahrhundert der ahd. Zeit die damals noch aktiven zahlreichen - ing -Namen als Ausdruck der Inbesitznahme des neuen Territoriums im allerdings von Slawen bewohnten Land mit sich brachte. Die damals ebenfalls noch aktiven - heim -Namen fanden aber unter solchen Gegebenheiten keinen rechten Platz. Erst im 11. Jh. folgten dann als Ausbausiedlung die vielen - dorf -Namen.
Читать дальше