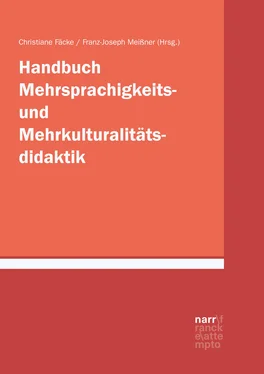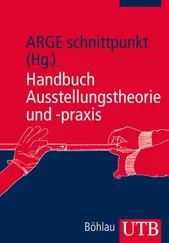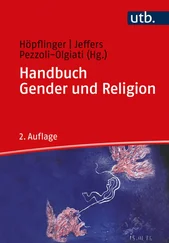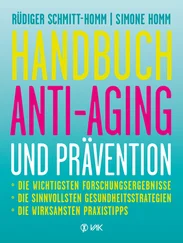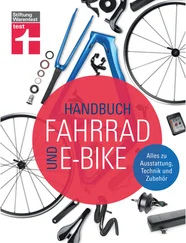*
Mit der Vielfalt der Beiträge will dieses Handbuch den state of the art der Forschungen und die zahlreichen praktischen Erfahrungen und Perspektiven auf dem Feld der Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik darstellen und so einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Diskurse im Rahmen aktueller erziehungswissenschaftlicher, erst-, zweit- und fremdsprachendidaktischer, z.T. sachfachdidaktischer und allgemein gesellschaftspolitischer Fragen unserer Zeit leisten.
Bennett, M. J. (1993): Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In: M. R. Paige (Hrsg.): Education for the intercultural experience. Yarmouth, 21-71.
Bertrand, Y. & Christ, H. (Koord.) (1990): Vorschläge für einen erweiterten Fremdsprachenunterricht. In: Neusprachliche Mitteilungen 43, 208-212.
Bonnet, A. & Siemund, P. (Hrsg.) (2018): Foreign Language Education in Multilingual Classrooms. Amsterdam, Philadelphia.
Byram, M. (1997): Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence . Clevedon u. a.
Council of Europe (2009): Autobiography of Intercultural Encounters . [http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf]
Dörnyei, Z. (2003): Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, research and applications. In Z. Dörnyei (Hrsg.): Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, research and applications . Oxford, 3-32.
Durkheim, E. (1978) : De la division du travail social . 10. Aufl. Paris. (Erstauflage: 1893)
F.I.P.F. (1990): Langue française, langues latines. La latinité, c'est la première frontière à franchir pour la francophonie. In: Lettre de la FIPF 48, 3-4.
Fäcke, C. (2005): Französischunterricht heute: Theoretische Positionen, didaktische Leitlinien, konkrete Umsetzungen. Eine Bestandsaufnahme – insbesondere im Hinblick auf interkulturelles Lernen. In: Neusprachliche Mitteilungen 58/4, 5-16.
Fäcke, C. (2015): Lingua Franca versus Mehrsprachigkeit. Theoretische Konzepte und praktische Umsetzungen in Europa. In: Zeitschrift für romanische Sprachen und ihre Didaktik 9/1, 25-42.
Fereidooni, K. (2012): Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen – Benachteiligung aus (Bildungs-)politischen Ursachen? In: Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 3, 363-371. [https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/fereidooni_aus_gwp3_2012.pdf]
Franceschini, R. (2004): Leben mit mehreren Sprachen. Vivre avec plusieurs langues. Sprachbiographien. Biographies langagières . Bern.
Frederking, V. (Hrsg.) (2008): Schwer messbare Kompetenzen. Herausforderungen für die empirische Fachdidaktik . Baltmannsweiler.
Gogolin, I. (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule . Münster.
Meißner, F.-J., Beckmann, C. & Schröder-Sura, A. (2008): Mehrsprachigkeit fördern. Vielfalt und Reichtum in der Schule nutzen (MES). Zwei deutsche Stichproben einer internationalen Studie in den Klassen 5 und 9 zu Sprachen und Fremdsprachenunterricht. Tübingen. [http://www1-uni-giessen.de/rom-didaktik/Multilingualism/]
Meißner, F.-J. & Lang, A. (2005): Fremdsprachenunterricht in Deutschland in der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums im Europäischen Jahr der Sprachen (2000/1). In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 16/2, 187-216.
Meißner, F.-J. & Schröder-Sura, A. (2014): Didactique de l'intercompréhension = Interkomprehensionsdidaktik ? Observations lexicologiques et politiques à propos d'une néologie de l'Union européenne. In: C. Troncy (Hrsg.): Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures. Autour de Michel Candelier . Rennes, 413-422.
Meißner, F.-J. (2014): Plurilingual Education. In: C. Fäcke (Hrsg.): Language Acquisition. Manuals of Romance Linguistics. New York, 219-235.
Schröder, K. (2009): Englisch als Gateway to Languages . In: C. Fäcke (Hrsg.): Sprachbegegnung und Sprachkontakt in europäischer Dimension . Frankfurt a.M., 69-85.
Statistica (2019): Anzahl der voll- und teilzeitbeschäftigten sowie stundenweise beschäftigten Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland im Schuljahr 2017/2018 nach Bundesländern. [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201496/umfrage/anzahl-der-lehrer-in-deutschland-nach-bundeslaendern/]
Wiese, H., Schröder, C., Zimmermann, M. et al. (o.J.): Die sogenannte „Doppelte Halbsprachlichkeit“: eine sprachwissenschaftliche Stellungnahme . [http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung_doppelte-halbsprachigkeit_dez2010.pdf]
Wolski, W. & Dralle, A. (2019): Kompaktwörterbuch Deutsch als Fremdsprache . Stuttgart, 469.
Christiane Fäcke & Franz-Joseph Meißner
A Sprachlichkeit und Kulturalität
1. Sprachlichkeit, Identität, Kulturalität
1. Einleitung
Es ist kein Zufall, dass die Herausgeber für diesen Artikel nicht den Titel „Sprache, Identität, Kultur“ vorgeschlagen haben, sondern „SprachlichkeitSprachlichkeit, IdentitätIdentität und KulturalitätKulturalität“. Damit wird ein konzeptueller Wandel angedeutet, der sich nicht zuletzt im Zuge poststrukturalistischen Denkens in weiten Bereichen der Human- und Sozialwissenschaften vollzogen hat. In Bezug auf das Konzept „Sprache“ setzen viele den Akzent nicht mehr auf Sprache als ein von anderen Sprachen abgrenzbares linguistisches System, das unabhängig vom Sprecher/Lerner gedacht wird, sondern auf Sprache als Ressource bzw. Mehrsprachigkeit als integratives Repertoire der Lernenden, mit Hilfe dessen sprachlich gehandelt wird. Mit „Sprachlichkeit“ wird also ein subjektorientiertes Sprachkonzept zum Ausdruck gebracht.
Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie „KulturKultur“ bzw. „Kulturalität“. Während Kultur lange (und zum Teil auch heute) als ein abgrenzbares, beobachtbares System betrachtet und diesem i.d.R. ein gewisses Maß an Homogenität zugeschrieben wurde, verschiebt sich der Blick nun eher auf ein diskursiv-reflexives Verständnis von Kultur (↗ Art. 32), d.h. Kultur bzw. Kulturalität wird als Vermögen zur Sinn- und Bedeutungsstiftung und damit auch als gesellschaftliche Praxis verstanden (Gutmann 1998).
Interessant und folgerichtig ist, dass im Laufe dieser epistemologischen Entwicklungen auch essentialistische Vorstellungen von Identität dekonstruiert wurden (↗ Art. 40). Darüber hinaus spielt Identität für sprachdidaktische Überlegungen eine immer wichtigere Rolle. Sowohl in interkulturellen Ansätzen (v.a. im europäischen Raum) als auch in sozio-kulturellen Ansätzen (u.a. im US-amerikanischen Raum) wird die Bedeutung von Identität für das Verständnis von SprachlernSprachlernprozess- und -lehrprozessen stark hervorgehoben.
Das Konzept „Sprachlichkeit“ – im Gegensatz zu „Sprache“ – beinhaltet vor allem drei Aspekte, die für die Didaktik der Sprachen und verwandte Forschungsbereiche von Bedeutung sind.
Zum einen wird die Perspektive auf die Akteure gerichtet, d.h. Sprache wird nicht, wie in strukturalistischen Sprachauffassungen üblich, als vom Sprecher/Lerner getrenntes „sprachliches System“ verstanden, sondern als soziale Praktik der Lernenden selbst und Teil ihrer Identität. Diese Positionierung beinhaltet eine Abwendung von vorrangig kognitiv-mentalistischen Auffassungen von Sprache bzw. Spracherwerb. Kennzeichnend hier ist etwa die einflussreiche Debatte um einen Artikel von Firth & Wagner (1997; 2007), in dem diese eine vorrangig kognitiv ausgerichtete Spracherwerbsforschung und damit einhergehende Konzepte wie z.B. das Konzept des native speaker native speaker, von interlanguage interlanguage oder Input/Output Input/Output kritisieren und im Gegenzug ein poststrukturalistisches Konzept von Sprache bzw. Sprachenlernen/Spracherwerb eingefordert hatten. Sprache wurde von ihnen nicht individualistisch, monolingual und formalistisch verstanden, sondern eindeutig praxeologisch, sozial und kontextgebunden (2007: 802). Wie später Pennycook (2010) feststellt:
Читать дальше