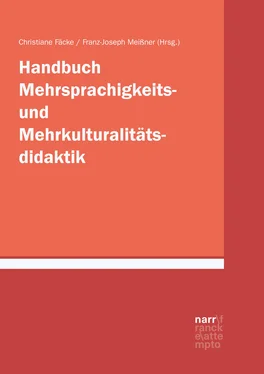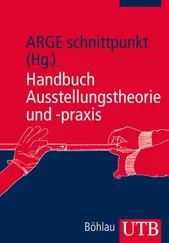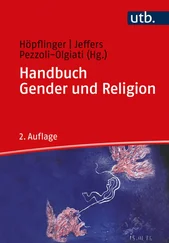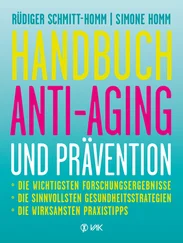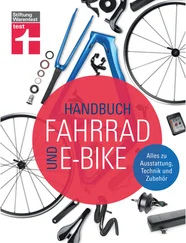Wir sollten nationale Kulturen nicht als etwas Einheitliches, sondern als einen diskursiven Entwurf denken, der Differenz als Einheit oder Identität herstellt. Sie sind von tiefen inneren Spaltungen und Differenzen durchzogen und nur durch die Ausübung ,kultureller Macht ‘ ,vereinigt‘. (Hall 1994: 206)
Bei SpracheSprache/Sprachlichkeit, IdentitätIdentität sowie KulturKultur/Kulturalität handelt es sich um Kernkonzepte der Human- und Sozialwissenschaften, insbesondere auch für pädagogische und sprachdidaktische Forschungsbereiche. Im Zuge poststrukturalistischen Denkens und den damit einhergehenden epistemologischen Neuorientierungen kristallisiert sich zunehmend die Interdependenz dieser drei Konzepte heraus. Sprache – nun verstanden als soziale Praxis – bildet in dieser Sichtweise die Wirklichkeit nicht ab, sondern erschafft diese. Gleichzeitig werden Sprachen nicht mehr als trennbare systemische Einheiten verstanden, sondern als heteroglossische RessourcenRessourcenfremdsprachlicheRessourcenheteroglossische von Personen. Essentialisierende Vorstellungen von Identität werden dekonstruiert und dagegen im Sinne narrativer, also sprachlich-diskursiv hervorgebrachter Identitäten konzeptionalisiert. Auch hier wird der Akzent zudem auf die grundsätzliche Hybridität von IdentitätHybridität u. Identität gelegt. Das gleiche gilt für Kultur bzw. Kulturen. Kultur und Sprache werden in engster Verbindung gesehen, und normative Kulturkonzepte als Strategie zur Durchsetzung von Machtinteressen interpretiert. Zudem wird auch hier der Fokus auf Vermischung, intrakulturelle Differenzen und Widerstreit bzw. den Inszenierungscharakter von Homogenität gelegt (↗ Art. 40).
Für aktuelle Positionen innerhalb der Mehrsprachigkeitsforschung waren diese Entwicklungen von großer Bedeutung. So sind die Vorstellungen etwa von plurilinguisme (im Gegensatz zu additiv verstandenem multilinguisme multilinguisme“ (z.B. bei Coste, Moore & Zarate 2009) (↗ Art. 18, 19), die Theorie des TranslanguagingTranslanguaging (z.B. bei Garcia & Li 2014), aber auch Theorieentwicklungen in der Mehrkulturalitätsforschung, etwa die Konzeption von Transkulturalität (z.B. bei Welsch 1997) durch die veränderten Verständnisweisen von Sprache, Kultur und Identität geprägt.
Bakhtin, M. (1981): The dialogic Imagination. Four Essays by M.M. Bakhtin . Austin.
Bhabha, H. (1990): Nation and Narration . London.
Böhme, H. (2012): Kulturwissenschaft. In: R. Konersmann (Hrsg.): Handbuch Kulturphilosophie . Stuttgart/Weimar, 31-38.
Bronfen, E. & Marius, B. (1997): Hybride Kulturen. Einleitung zur anglo-amerikanischen Multikulturalismus-Debatte. In: E. Bronfen, B. Marius & T. Steffen (Hrsg.): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismus-Debatte . Tübingen, 1-30.
Bruner, J. (1990): Acts of Meaning . Cambridge, Mass.
Busch, B. (2013): Mehrsprachigkeit . Wien.
Chambers, I. (1994): Migrancy, Culture, Identity . London & New York.
Coste, D., Moore, D. & Zarate, G. (2009): Plurilingual and Pluricultural Competence . Strasbourg.
Firth, A. & Wagner, J. (1997): On Discourse, Communication, and (Some) Fundamental Concepts in SLA Research. In: The Modern Language Journal 81/3, 285-300.
Firth, A. & Wagner, J. (2007): Second/Foreign Language Learning as a Social Accomplishment: Elaborations on a Reconceptualized SLA. In: The Modern Language Journal 91, 800-819.
Foucault, M. (1994): Warum ich Macht untersuche. Die Frage des Subjekts. In: H. Dreyfus, P. Rabinow & M. Foucault (Hrsg.): Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik . Weinheim, 243-250.
Garcia, O. & Li, W. (2014): Translanguaging: Language, Bilingualism and Education . Basingstoke.
Gilroy, P. (1999): Race and Culture in Postmodernity. In: Economy and Society 28, 183-197.
Göller, T. (2000): Kulturverstehen. Grundprobleme einer epistemologischen Theorie der Kulturalität und kulturellen Erkenntnis . Würzburg.
Grossberg, L. (1999): Was sind Cultural Studies? In: Hörning & Winter (Hrsg.), 43-83.
Gumperz, J. J. (1964): Linguistic and Social Interaction in Two Communities. In: American Anthropologist 66, 137-153.
Gutmann, M. (1998): Der Begriff der Kultur . Prälimininarien zu einer methodischen Phänomenologie der Kultur in systematischer Absicht. In: D. Hartmann & P. Janich (Hrsg . ): Die kulturalistische Wende. Zur Orientierung des philosophischen Selbstverständnisses . Frankfurt a.M., 269-332.
Hall, S. (1994): Rassismus und kulturelle Identität , Hamburg.
Hall, S. (1996): Introduction: Who Needs 'Identity'? In: S. Hall & P. du Gay (Hrsg.): Questions of Cultural Identity. London, 1-17.
Hörning, K. H. & Winter, R. (1999): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung . Frankfurt a. M.
Hu, A. (1999): Identität und Fremdsprachenunterricht in Migrationsgesellschaften . In: L. Bredella & W. Delanoy (Hrsg.): Interkultureller Fremdsprachenunterricht . Tübingen, 209-239.
Hu, A. (2005): Grenzüberschreitung in der Rhetorik postkolonialer Theoriebildung. In: S. Duxa, A. Hu & B. Schmenk (Hrsg.): Grenzen überschreiten. Menschen, Sprachen, Kulturen . Tübingen, 101-114.
Hu, A. (2013): “On regarde une langue à travers l'autre”. Mehrsprachigkeit als Wert und Herausforderung. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German Studies 38, 15-29.
Kerby, A. P. (1991): Narrative and the Self . Bloomington.
MacIntyre, A. (1995): Der Verlust der Tugend. Frankfurt a. M.
Norton, B. (1997): Language, Identity, and the Ownership of English. In: TESOL Quarterly 31/3, 409-430.
Nünning, A. (Hrsg.) (2001): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie . Stuttgart.
Pennycook, A. (2010): Language as a Local Practice. London.
Ricœur, P. (1985): History as Narrative and Praxis. In: Philosophy today 29/4, 212-225.
Straub, J. (2004): Identität. In: F. Jäger & B. Liebsch (Hrsg.): Kulturwissenschaften. Ein Handbuch . 1: Kontexte und Grundbegriffe . Stuttgart, 277-303.
Swain, M. (2006): Languaging, Agency and Collaboration in Advanced Second Language Proficiency. In: H. Byrnes (Hrsg.): Advanced Language Learning: The Contribution of Halliday and Vygotsky . London, 95-108.
Wägenbaur, T. (1995): Kulturelle Identität oder Hybridität? Aysel Özakins Die blaue Maske und das Projekt interkultureller Dynamik. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 25/1, 22-47.
Welsch, W. (1997): Unsere Postmoderne Moderne . Berlin.
Adelheid Hu
2. Staatliche (kollektive) und individuelle Mehrsprachigkeit
Nach Gardou (2013: 31) ist nichts stärker durch die Gemeinschaft geprägt als die Herausbildung der persönlichen Identität (↗ Art. 1)Identität. Aufs engste mit der Sozialisation verbunden sind Sprach- und erst recht Mehrsprachenerwerb (↗ Art. 51)Mehrsprachenerwerb, SprachenpflegeSprachenpflege und SprachenwachstumSprachenwachstum. Spracherwerb ist immer individuell, idiosynkratisch, dynamisch und sozial geprägt. Er setzt frei nach Chomsky neben einem Spracherwerbsapparat ( language acquisition device language acquisition device, LAD) soziale Interaktion, ein social support system social support system (LASS), zwischen einem Erwerber und weiteren beteiligten Personen voraus. Auch diese sind natürlich durch ihre jeweilige Sozialisation geprägt und Träger von Idiolekten. Die mentale Verarbeitung von Sprache ist nicht einseitig erwerbsfixiert: Sprachkompetenz kann sich auch zurückbilden (vgl. Attrition).
Читать дальше