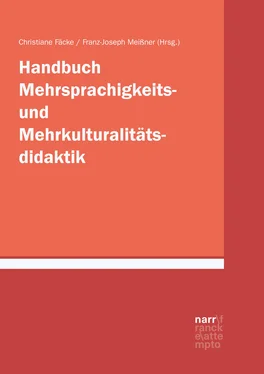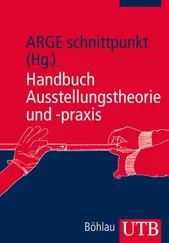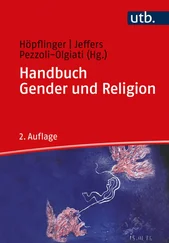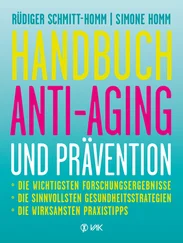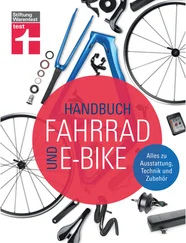Nun haben unterschiedliche Kulturen und Kulturkreise nicht unbedingt dieselben Werte. Und ein hoher Anteil an Migranten aus unterschiedlichen Herkunftskulturen gibt die von ihnen internalisierten WerteWerte nicht einfach bei einem Grenzübertritt ab. Nur langsam gelingt es vielen von ihnen, sich in den Wertekanon der aufnehmenden Gesellschaft einzufinden. Dies verlangt eine enorme Anpassungsleistung. Erfahrungsgemäß kann dies mehr als eine Generation dauern. Gesellschaften, die sich als plural verstehen, müssen den Eingewanderten die notwendige Zeit lassen und Hilfen bieten. Kenntnisse der Mehrheitssprache sind hierzu ein erster Schritt.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob und auf welcher Grundlage ein friedliches Miteinander basieren kann. Lassen sich universalistische Wertesysteme (↗ Art. 37) finden, auf die sich alle Beteiligten voll umfänglich einigen können? In der Regel eher nicht, wie das Beispiel kontrovers diskutierter Vorstellungen von Familienehre aufzeigt, die unterschiedlich über Einstellungen zum Sexualverhalten der Töchter definiert wird.
Über den Bezirk der Ehre hinaus reichen Konventionen. Ein Blick zurück zeigt, dass die Anschauungen der Mehrheitsgesellschaft sich wandeln können: IKonventionennterkonfessionelle Ehen galten noch vor wenigen Jahrzehnten als anrüchig, Homosexualität war ein Straftatbestand.
In Deutschland diskutierte Konventionen von Minderheiten betreffen z.B. die folgenden Punkte:
Das Schächten von Tieren findet nicht die Zustimmung der deutschen Mehrheitsgesellschaft; gleichwohl geschieht es aus religiösen Gründen, zumal das Bundesverfassungsgericht die religiöse Praxis erlaubt hat.
Ebenso wenig erhält die Beschneidung von Jungen oder Mädchen im Judentum oder im Islam aus religiösen Konventionen die Zustimmung der hiesigen Mehrheitsgesellschafft.
Das Tragen des Kopftuches von muslimischen Frauen ist seit Jahrzehnten ein in Deutschland und Österreich umstrittenes Thema. Während es den Trägerinnen als Ausweis ihrer Identität gilt, halten andere – Muslima und andere – es für ein Zeichen der Unterdrückung oder des Wunsches, gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft ‚Andersheit‘ und ‚Ablehnung‘ zu signalisieren.
Fazit: Gegenläufige Ehrauffassungen und Konventionen können spalten, sie schaffen Wir-Wir-Gruppen und Sie-Gruppen. Konfliktpotenziale sind gegeben, Konflikte vorprogrammiert. Aufklärung tut not.
Eine der klassischen Wir-Gruppen sind Religionsgemeinschaften, denn Religionen greifen in starker Weise auf die Wertekonstruktion von Menschen zu; und zwar in der Tendenz umso stärker, je weniger sie an Säkularisierung partizipierten. Andere wichtige Wir-Gruppen sind z.B. Nationen oder Ethnien.
Bestimmte Wertesysteme hingegen beanspruchen universelle Gültigkeit. Am 10. Dezember 1948 verkündet die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als „das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal“, das die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aller Menschen (Artikel 1) sowie das Verbot der Diskriminierung (Artikel 2) umfasst. Der hier formulierte Maßstab folgt einem universalistischen Anspruch, der einen Rahmen für ein weltweites friedliches Miteinander bieten soll und bereits in der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution angelegt war.
Die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen des Jahres 1789 jedoch wird kurze Zeit später von Olympe de Gouges dahingehend kritisiert, dass die Revolution die Frauen vergessen habe. Eine andere Infragestellung erfolgte in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte MenschenrechteKairoer Erklärung der im Islam , die 1990 etliche WerteWerte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte MenschenrechteAllgemeine Erklärung der als Ausdruck eines individualistischen westlichen Denkens ablehnt. Angesichts dieser Beispiele stellt sich die Frage nach der Begründung und Begründbarkeit eines universellen Anspruchs der Menschenrechte für alle.
Wer also den universellen Anspruch der Menschenrechte (aus guten Gründen) nicht aufgeben will, wird – um der friedlichen Koexistenz und der Vermeidung von Konflikten willen – gegenüber ihrer Relativierung eine kritische Toleranz praktizieren müssen. Im Bereich des deutschen Grundgesetzes ist eine solche Relativierung, welche die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte aufhebt, freilich verboten, weil verfassungsfeindlich.
Diese Fragen sind auch für Erziehung und Unterricht relevant. Die Schule muss einerseits darauf vorbereiten, Fremdheit auszuhalten und aushalten zu wollen, andererseits zur VerfassungstreueVerfassungstreue erziehen. Dies erklärt, weshalb die Mehrkulturalitätsdidaktik stark auf Einstellungen und VolitionalitätVolitionalität sowie auf politische Urteilkraft abhebt.
Generell sind einstellungsbezogene, attitudinale und volitionale RessourcenRessourcenvolitionaleVolitionalität grundlegend für jegliche Kompetenzbildung. Ohne sie können Kompetenzen der Domänen von WissenWissen ( knowledge ) und KönnenKönnen ( can do ) nicht miteinander verbunden und aktiviert werden. Dies gilt auch für den Bereich der Mehrkulturalität. Betroffen sind hier 1.) das landeskundliche und das interkulturelle Faktenwissen ( knowledge, savoir ), 2.) das Wissen, wie man dieses Wissen zur Anwendung bringt ( savoir-faire, can do ), z.B. konkretes Handlungswissen im Umgang mit Fremdheit und heterokulturellen Personen praktizieren, 3.) schließlich das Wissen zur Selbststeuerung: Selbstaufmerksamkeit, Kontrolle der eigenen Einstellungen und Handlungen, der Wirkung von interkulturellen Erfahrungen bzw. des PerspektivenwechselsPerspektivenwechsel auf das Selbst, Empathie, KritikfähigkeitKritikfähigkeit gegenüber dem Eigenen und dem Fremden, Bereitschaft zur Revision von Vor-UrteilenRevision von Vor-Urteilen ( attitudes, savoir-être ) (Byram 1997). Leider werden die Einstellungen im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht vielfach wenig reflektiert, in interkulturellen Diskursen hingegen geschätzt.
Anders als solche des Sprachenwachstums gehören interkulturelle Kompetenzen zu den schwer messbaren Kompetenzen (Frederking 2008) (↗ Art. 48, 49). Eine Möglichkeit der Evaluation eröffnet z.B. das Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) von Milton Bennett (1993), das u.a. in der DESI-Studie verwendet wurde und das verschiedene Entwicklungsstufen von Ethnozentriertheit zu Ethnorelativierung erfasst. Neben diesem quantitativen Zugriff werden häufig eher qualitative Zugangsweisen favorisiert, die zudem auf der Binnenperspektive der Beteiligten aufbauen (z.B. die Autobiography of Intercultural Encounters , Council of Europe 2009). Einen Katalog von Deskriptoren bietet der RePA (↗ Art. 20). Qualitative Studien beschreiben sprachbiographische Erfahrungen (Franceschini 2004), Sprachenbilder, Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung, – um nur die hervorstechendsten Referenzbereiche anzuführen.
2.5. Qualitätsentwicklung im sprachlich-kulturellen Lernfeld
Spätestens seit der Teilnahme Deutschlands an den großen internationalen OECD-Vergleichsstudien im Bildungswesen bemüht sich das Land um empirisch belastbare Qualitätsstandards. Neben den traditionellen Maßnahmen – Richtlinien für den Unterricht, Abschlussprüfungen, Lehrerausbildung und eine entsprechende Aufsicht durch die Ministerien – sind BildungsstandardsBildungsstandards Ausdruck dieser Orientierung. Qualitätsentwicklung setzt eine empirische Bildungsforschung (pädagogische Psychologie und Fachdidaktiken) voraus, die in der Lage ist, der politischen Steuerung des Bildungswesens wissenschaftliche Fundierung zu verleihen. Dass eine longitudinale Beobachtung von Unterrichtsprozessen im Kontext von Schule nur eingeschränkt möglich ist, erklärt, weshalb zurzeit im quantitativen Bereich vor allem sog. LeistungsstudienLeistungsstudien vorliegen, die das Ergebnis von Bildungsbemühungen messen. Deutlich seltener sind dagegen Erhebungen zu UnterrichtserlebnisUnterrichtserlebnis, LernerfahrungenLernerfahrungen und LernabsichtenLernabsichten (Meißner et al. 2008; in gewissem Umfang auch DESIDESI-Studie). Dabei ist festzustellen, dass Deutschland einer ländervergleichenden Studie zum Jahr 2004 zufolge, was den Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe II betrifft, keine einheitliche Bildungslandschaft darstellt (Meißner & Lang 2005). Betroffen sind die Belegungen von Fremdsprachen und Kursen in der Sekundarstufe II. Eine erneute Erhebung ist im Jahre 2019 überfällig; zumal nie untersucht wurde, welche Folgen die signifikanten Unterschiede von Fremdsprachenbelegungen auf den weiteren Bildungsverlauf der Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Bundesländern hatten.
Читать дальше