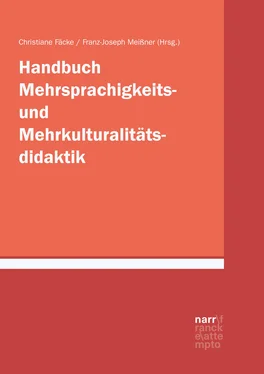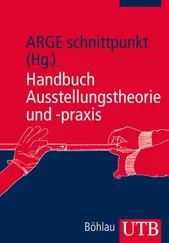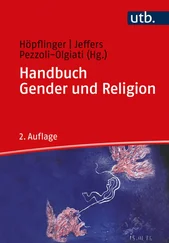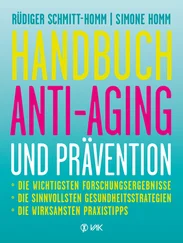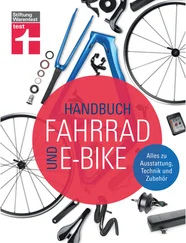Der GeRGeR und vor allem der CEFR Companion Volume transportieren, wie angeklungen, die Unterscheidung zwischen multicultural/multiculturel/multikulturell multikulturell einerseits und pluricultural/pluriculturel/mehrkulturell mehrkulturell andererseits (↗ Art. 18, 19). In einer vielkulturellen Umgebung und einem vielkulturellen Europa ( multicultural Europe und multicultural environment ) sollen pluricultural competences und ein pluricultural repertoire entwickelt werden. Das Präfix multi- dient, wie gesagt, zur Hervorhebung gesellschaftlicher Dimensionen, während das Präfix pluri- individuelle Dimensionen meint.
Generell deuten die pluri -Begriffe auf konkrete Planbar- und Organisierbarkeit von gezieltem Unterricht. Hingegen sind die multi- Bildungen semantisch offener.
Eine Politik zugunsten von mehr Mehrsprachigkeit und mehr Mehrkulturalität fällt auf unterschiedliche nationale Substrate (und deren eigenständige Interessen). Die Geschichte der europäischen Nationalstaaten ist eng mit ihren jeweiligen NationalsprachenNationalsprachen und einer sie begünstigenden SprachpolitikSprachpolitik verbunden. Während die Nationalsprachen längst hinlänglich normiert waren, beherrschten die jeweiligen nationalen Bevölkerungen diese bis weit ins 19. Jh. hinein nur unzureichend: Die meisten Menschen sprachen Dialekte und in den Vielvölkerstaaten zumeist auch unterschiedliche Sprachen. Vorrangige Aufgabe war im Zuge von Industrialisierung, Urbanisierung, der Entstehung gänzlich neuer Berufsgruppen wie der Angestellten, der Industriearbeiterschaft und weiterer die Herstellung eines einheitlichen nationalen Kommunikationsraums, an dem die Gesamtbevölkerung im Rahmen einer vor allem national miteinander kommunizierenden Wirtschaft teilhaben konnte. Träger dieser Entwicklung waren das allgemeine Schulwesen, die allgemeine Wehrpflicht, die Verbreitung von Presse und Radio zu Beginn des 20. Jhs. Die Lage erklärt, weshalb das jeweilige nationale ErziehungswesenErziehungswesennationales des 19. und überwiegend des 20. Jhs. der Zwei- und Mehrsprachigkeit nicht förderlich gegenüberstand. Eine Politik zugunsten der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität gab es in nur wenigen Fällen – kaum jedoch in nennenswertem Umfang in großen Nationalstaaten wie Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland oder Russland. Eine gewichtige Ausnahme stellte der ehemalige Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn dar (Fäcke 2015). Die Verbreitung der Amtssprachen fand ihre Erweiterung in den Kolonien.
2. Perspektiven einer Sprachen und Kulturen vernetzenden Didaktik
Die einzelne Zielsprachen übergreifenden und vernetzenden didaktischen Ansätze, welche in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, sind nicht ohne Bezug zu den Didaktiken der einzelnen Sprachen, z.B. zur Englisch‑, Französisch‑ oder Deutsch als Fremdsprache-Didaktik und ihrer langzeitlichen Entwicklung. Konzepte wie die schon genannten – vernetzendes SprachenlernenSprachenlernenvernetzendes, Gesamtsprachencurriculum (↗ Art. 14), Interkomprehensionsdidaktik (↗ Art. 70),Interkomprehensionsdidaktik Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik (↗ Art. 7, 8) überhaupt – wollen die einzelsprachlichen Didaktiken konzeptuell und methodisch im Sinne der Lernziele MehrsprachigkeitLernziel Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz ergänzen und bereichern. Die Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik ist eine sog. TransversaldidaktikTransversaldidaktiken. Ihre beiden Zweige wollen die einzelzielsprachlichen Fachdidaktiken nicht verdrängen, sondern sie ergänzen. Dies berührt zunächst die Didaktiken der Erstsprachen bzw. der hiesigen offiziellen Schulsprachen, sodann der ZweitsprachenZweitsprache und der unterrichteten Fremdsprachen. Da es sich bei diesen vor allem um europäische Sprachen handelt, lassen sich zwischen ihnen zahlreiche Ähnlichkeiten – TransferbasenTransferbasis – ausmachen, deren Nutzung den Erwerb einer neuen Sprache oder die Verbreiterung der interkulturellen Kompetenz erleichtert. Dies gab den Anstoß für die Entwicklung der Interkomprehensionsdidaktik. Für Konzepte des interkulturellen Lernens war es von vornherein konstitutiv.
Reflexives Sprachenlernen begegnet in allen Formen des Sprachen miteinander vernetzenden Lehrens und Lernens. Hier überlappen sich die Felder von Sprachpolitik (Sprachpolitikzugunsten der jeweiligen eigenen Nationalsprache) und Sprachenpolitik (SprachenpolitikFörderung ausgewählter Fremdsprachen innerhalb eines nationalen Territoriums – z.B. durch die Einrichtung eines entsprechenden Schulfachs, etwa Englisch, Französisch oder aber Sorbisch in Deutschland).
2.1. Sprachenvernetzende Ansätze zwischen Sprach- und Sprachenpolitik (Interkomprehension)
Zahlreiche Faktoren bestimmen die Stellung einer Sprache auf dem internationalen Sprachenmarkt, in bunter MischungSprachenmarkt: die Zahl der Muttersprachler und der zweit- und fremdsprachlichen Sprachteilhaber, das kulturelle Prestige, die Kraft der jeweiligen Volkswirtschaft, der Status in internationalen Organisationen, die kommunikative Reichweite in den Wissenschaften, die Rolle im Alltagsleben der Menschen, ihre reale und virtuelle Erreichbarkeit bzw. ihre Präsenz in den Medien und dem Internet und last but not least ihre Erlernbarkeit.
Apropos kommunikativer Radiuskommunikativer Radius: Sein Gewicht für die internationale Stellung einer Sprache verdeutlicht unübersehbar das Englische, für das schwer zu übersehen ist, ob es die fast 350 Mio. nativen Sprachteilhaber, die geschätzt 300 Mio. Zweitsprachensprecher oder die ca. 2 Mrd. heteroglotten Sprachteilhaber bzw. täglichen (heterokulturellen) Nutzer der globalen intersociety intersociety sind, die seinen hohen internationalen Marktwert bestimmen (↗ Art. 13, 97, 98).
Dies allein schon erklärt, weshalb Sprachen ihre Stellung am Markt verbessern können, wenn ihre Kenntnis es erlaubt, auch weitere attraktive Sprachen zu verstehen und ihr Erlernen zu erleichtern. So findet das Französische in der spanischen oder italienischen Sprache sehr starke ‚Verbündete‘ und diese umgekehrt im Französischen. „Wenn du Spanisch oder Italienisch lernst, helfen dir Französischkenntnisse ungemein. – Mit dem Erlernen einer romanischen Sprache legst du die Grundlage für das leichte und rasche Erlernen quasi aller romanischen Sprachen (800 Mio. native Sprecher, ungezählte Mio. Zweit- und Fremdsprachensprecher).“ Das Argument, das natürlich auch für andere Sprachen und deren Familien als die genannten gilt, hat Gewicht, wenn es um die Überlegung geht, welche Sprache ein Kind oder ein Erwachsener lernen soll. Ein weiterer Faktor betrifft den Status einer Sprache als SchulfremdspracheSchulfremdsprachenStatus innerhalb der Gesellschaft: So zeigen die Lernerkontingente der VolkshochschulenVolkshochschulen, wie sehr ein durch die Schulfremdsprachen vermitteltes Wissensprofil die Nachfrage nach bestimmten Fremdsprachen steigert.
Dabei ist klar, dass sich von keiner Fremdsprache außer Englisch behaupten lässt, dass ein heutiges Kind diese Sprache in seinem späteren Erwerbsleben auch wirklich braucht (SprachenbedarfSprachenbedarf). Umso wichtiger ist die Vermittlung von SprachlernkompetenzSprachlernkompetenz, die sich vor allem mit dem Erlernen einer zweiten und dritten Fremdsprache bzw. interkomprehensiver Verfahren ausbilden lässt, da es wesentlich auf die Fähigkeit des zielgerichteten VergleichensVergleichen sprachlicher Strukturen ankommt (u.a. Schröder 2009).
Die offizielle und offiziöse Sprachpolitik der einzelnen Sprachen hat auf derlei Fakten reagiert: In der Romania zeigen dies vor allem die von französischer Seite initiierten organisatorischen Maßnahmen zur SprachlenkungSprachlenkung (Schmitt 1988a und 1988b), die Gründung der Union Latine sowie zahlreiche EU-finanzierte Projekte (GalateaGalatea, Eurom4Eurom4, EuroComEuroCom, RedinterRedinter, MIRIADIMIRIADI u.a.m.). Auch in Iberoamerika hat die Interkomprehension ein weites Echo gefunden (InterlatInterlat, InterromInterrom u.a.m.). Vor diesem Hintergrund bezeichneten zu Beginn der 1990er Jahre Dokumente der Fédération Internationale des Professeurs du Français (F.I.P.F.) die romanischen Schwestersprachen als „langues fédéréeslangues fédérées“ (F.I.P.F. 1990). Andere Sprachpolitiken, z.B. die der UdSSRUdSSR oder RusslandsRussland, sind diesen Weg jedoch nicht gegangen, obwohl die slawische Sprachenfamilie starke zwischensprachliche Ähnlichkeiten aufweist (↗ Art. 94, 108). Auch die TurksprachenTurksprachen halten ein erhebliches Potential für interkomprehensive Ansätze bereit.
Читать дальше