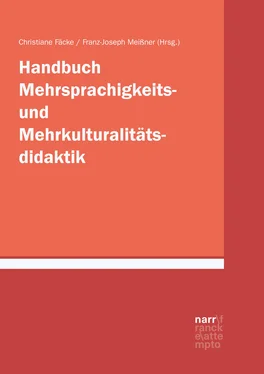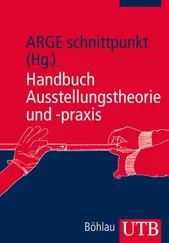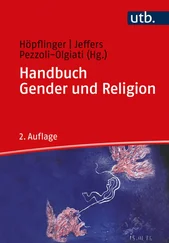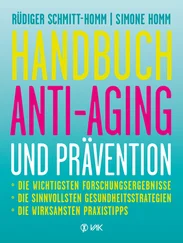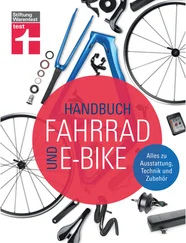unter MehrsprachigkeitMehrsprachigkeitpädagogische Definition nicht zu verstehen ist, man müsse mehrere Sprachen gleichermaßen beherrschen. Als mehrsprachig darf schon der bezeichnet werden, der auf der Basis der Kenntnis seiner Muttersprache eingeschränkte Kenntnisse in wenigstens zwei weiteren Sprachen entweder in gleichen oder verschiedenen Diskursbereichen hat (um z.B. soziale Kontakte in gesprochener oder geschriebener Sprache aufzunehmen oder Texte lesen oder Fachgespräche führen zu können). (Bertrand & Christ 1990: 208)
Das Handbuch folgt weitgehend dieser, für die Entwicklung der Mehrsprachigkeit wichtigen Definition.
1.2. Diskurse der Mehrkulturalität
Analog zu mehrsprachig benutzt dieses Handbuch mehrkulturell mehrkulturell – obwohl der Begriff im deutschsprachigen Wissenschaftsdiskurs deutlich weniger gängig ist als interkulturell oder selbst transkulturell . Mehrkulturell ist auf Individuen, ihre konkret nennbaren Kulturen und deren Manifestationen bezogen, mit denen sie mehr oder weniger vertraut sind (↗ Art. 17). Zugleich betont die konkrete Perspektivierung die Wichtigkeit des exemplarischen Lernens. Denn es existieren unzählige, zu viele kulturelle Fremdheiten, als dass wir uns mit ihnen allen vertraut machen könnten. Eine Auswahl, die uns tiefere Einblicke in die eine oder andere Kultur und die Wirkung ihrer Andersheiten auf uns selbst erlaubt, ist daher unumgänglich.
ExemplaritätExemplarität bildet die Verbindung zwischen mehrkulturellen und interkulturellen Modellen. Hierneben steht wie im Deutschen auch im Englischen, Französischen und in weiteren Sprachen der Begriff vielkulturell multikulturell ( multicultural/multiculturel ) in Opposition zu mehrkulturell ( pluricultural/pluriculturel ). Mehr als die anderen Eckbegriffe dieses Handbuchs zeigt gerade multikulturell die Spuren der politischen Praxis ( multikulturelle Gesellschaft, „multikulti multi-kulti “ ). Als tagespolitisches Programmwort unterschiedlicher Parteien ist es auch in der Bevölkerung in hohem Maße umstritten (↗ Art. 15). Dies erklärt nicht nur seine eigene starke emotive Aufladung, sondern auch die seines Begriffsfeldes bzw. seiner semantischen Nachbarn: Integration, Flüchtlinge/Geflüchtete, Identität, Herkunftssprachen, Leitkultur und Herkunftskulturen , deutsch und ausländisch, deutsch und Islam usw. sind immer auch Wörter einer ebenfalls hochgradig umstrittenen „WillkommenskulturWillkommenskultur“. Entsprechende Artikel des Handbuchs werden zu diesen gesellschaftlich durchaus breiten Entwicklungen zwangsläufig in eine Beziehung gesetzt, denn sie antworten ja auf aktuelle Entwicklungen und Perspektiven. Die politische Auseinandersetzung ist immer auch eine um Wörter und deren Sinnfüllung. Zustimmung erheischende Formeln (in der Sprache der politischen Semantik: Miranda) werden kreiert und in bestimmter Weise benutzt und verbogen: Der Begriff lebensweltliche Mehrsprachigkeitlebensweltliche Mehrsprachigkeit (↗ Art. 100) bezieht sich auf den sprachlichen Erfahrungsbereich konkreter Menschen – vorzugsweise Kinder mit Migrationshintergrund – nicht aber auf die Gesellschaft (↗ Art. 2), denn diese ist vielsprachig (Fereidooni 2012).
Ähnliches lässt sich zu Herkunftssprache (↗ Art. 106) sagen: Der alltagssprachliche Begriff zur Bezeichnung bestimmter Sprachen der Migration versteckt, dass alle Menschen eine sprachliche Herkunft haben, die spätestens dann ins Bewusstsein rückt, wenn sie eine zweite Sprache oder die sog. ‚Hochsprache‘ ihrer heimischen Varietät bzw. des eigenen Dialekts erwerbenInterlanguage. Wer immer eine zweite Sprache lernt, hat bereits eine erste, in der die Welt auf Begriffe gebracht wurde. Es erscheint daher linguistisch zutreffender wie im Englischen und Französischen ( languages of immigration, langues de l’immigration ) von Sprachen der Immigration zu sprechen. Gleichwohl wird der Begriff Herkunftssprache in den Artikeln dieses Handbuches verwandt, weil der Begriff im Deutschen konventionalisiert ist. Er sollte daher entsprechend modifiziert verstanden werden.
Sprache ist Wort gewordene Kultur (K. Schröder in diesem Band, ↗ Art. 10), Kulturen sind ohne Sprachen nicht denkbar. Sprache und Kultur sind Merkmale von Staaten. Kulturen sind auch von Gegensätzen geprägt. So ist die EU-Sprachenpolitik vielfach an ihre europäischen Kulturen und Mitgliedstaaten gebunden, und schon die Bildung der öffentlichen Meinungen geschieht auf nationaler wie EU-Ebene mithilfe von Sprachen. Dies hat insbesondere innerhalb demokratischer (und rechtsstaatlicher) Kulturen Gewicht (↗ Art. 9). So fällt im Vorfeld von Wahlen der öffentlichen Sprache die Aufgabe zu, die politischen Angebote der um die legitime Macht kämpfenden Parteien zu kommunizieren. Ohne Sprache wäre demokratisches Prozedere bzw. demokratische Kultur unmöglich. European citizenship European citizenship ist ein Begriff des interkulturellen und politischen Lernfeldes. Die Problematik der Vielsprachigkeit für die Bildung einer Öffentlichen Meinung und das politische Prozedere der EU ist bis heute nicht gelöst.
Dem Handbuch liegt ein weiter und pluraler Kulturbegriff (↗ Art. 1) zugrunde. In diesem Zusammenhang ist die gemeinsame Geistesgeschichte Europas, einschließlich der Alltagskulturen, relevant. Referenzbereiche sind Staatswesen und Kulturen bzw. Religionen, Wissenschaften, Künste, Sitten und Gebräuche und menschliche Praxen.
Spätestens seit den 1990er Jahren wird kulturellen Prägungen auch für das Sprachenlernen Bedeutung zugeschrieben. Insbesondere spielen die Sozialisierung und Enkulturation der Lerner (↗ Art. 4), die Zusammenhänge von Sprache und Identitätskonstruktion oder kulturspezifische Einstellungen eine Rolle, und zwar seitens der Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf Multikulturalität, Globalisierung, Migration sowie den Umgang mit ethnischer und kultureller Vielfalt, seitens der Migranten und Sprachenlerner der Integrationswunsch in die Zielgesellschaft X oder Sprachgemeinschaft und der Wunsch, sich Vorteile durch Kenntnis der Zielsprache und Zielkultur zu verschaffen (bei Dörnyei 2003 begegnet der Terminus Instrumentalität). Bzgl. der Erfahrung von ethnischer und/oder kultureller Diversität Diversitätethnische und kulturellelassen sich – grob – folgende Unterscheidungen treffen:
1 Fokussiert die Argumentation auf das Verhältnis zwischen ethnisch und kulturell deutlich voneinander abgegrenzten Personen (Gruppen, Gesellschaften, Nationen und Staatsvölker), so stehen i.d.R. angemessene (konventionalisierte) Umgangsweisen im Vordergrund. Für diesen Fall werden meist Kompositionen mit dem Präfix inter - verwendet: interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen oder interkulturelle Kommunikation zwischen dem Eigenen und dem Fremden (↗ Art. 32, 36). Solche Bildungen beziehen sich nicht auf Kontraste konkreter Kulturen, sondern fassen generell. Natürlich können Ergänzungen diese Polarität durch Konkretisierung (Typ: der interkulturelle deutsch-britische Dialog ) aufheben.
2 Liegt der Fokus indes auf dem Bestreben nach Aufhebung dieser Oppositionen, dann folgt hieraus die Absage an ein Verständnis von in sich homogenen und geschlossenen Kulturen (die sich von anderen Kulturen unterscheiden und sich nach außen abgrenzen). In diesem Fall wird oft das Präfix trans - genannt. Man spricht z.B. von einer (postmodernen) Transkulturalität (↗ Art. 41)Transkulturalitätሴiሴ.
Wie die Komplementarität von Vielsprachigkeit und Mehrsprachigkeit wird auch die von Interkulturalität und Transkulturalität nicht immer trennscharf benutzt.
Читать дальше