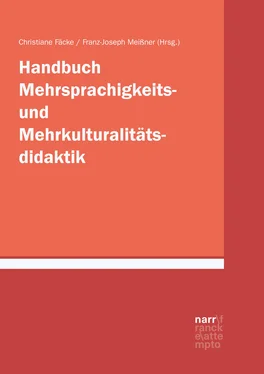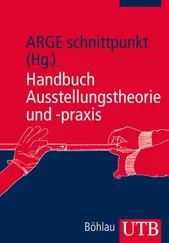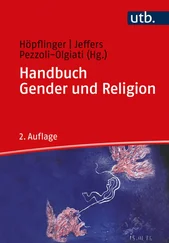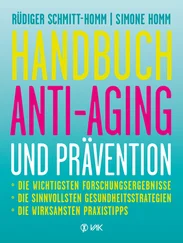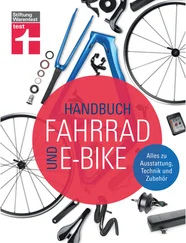Die Lernerkontingente der sog. ‚kleinen‘ Sprachen zeigen, wie sehr sie als Fremdsprachen von den mehrsprachigen Vorkenntnissen der Lerner profitieren. Sieht man einmal von der Migrationsbevölkerung ab, so lässt sich festhalten, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Katalanischkursen nicht nur über Kenntnisse im Englischen verfügt, sondern oft auch im Spanischen, im Französischen usw. Es ist eine offene Frage, ob sie einen Katalanischkurs auch ohne diese Vorkenntnisse und die eigenen Sprachlernerfahrungen belegt hätten (↗ Art. 91).
Zeigt der romanische Sprachraum ein deutliches Interesse an der Förderung von InterkomprehensionInterkomprehension, so bezeugt DeutschlandDeutschland eine gewisse Zurückhaltung. Dabei nimmt das Land insoweit eine besondere Stellung ein, als neben dem Englischen und dem Lateinischen vor allem das Französische und das Spanische eine weite Verbreitung als Schulfremdsprache verzeichnen. Verstärkt wird die hier entgegentretende Lernerdisposition z.T. auch durch eine in migrantischen Mehrsprachigkeitsmustern angelegte Kompetenz. So schnitt eine deutsch/russisch-zweisprachige Schülerin der Limburger Marienschule in einem zweiwöchigen Italienisch-interkomprehensiv-Unterricht an Primanerinnen eines Spanischkurses als beste ab (bei generell sehr guten Ergebnissen), obwohl sie als einzige weder Französisch- noch Lateinkenntnisse nachweisen konnte.
EnglischEnglisch-, FranzösischFranzösisch-, SpanischSpanisch- und LateinkenntnisseLatein und der in den Sachfächern erworbene deutsche BildungswortschatzBildungswortschatzdeutscher verleihen deutschsprachigen Kindern ein pädagogisch nutzbares Maß an Transferbasen für romanische Interkomprehensibilität (↗ Art. 7, 56). So können auch Deutschsprachige ihre mehrsprachigen Kenntnisse nutzen, um weitere, nicht nur romanische Sprachen zu erlernen. ‚Interkomprehension über die Familie der eigenen Muttersprache hinausInterkomprehensionüber die Familie der eigenen Muttersprache hinaus‘ lautet daher ein Ansatz, der in der deutschen Fremdsprachendidaktik starkes Interesse findet, zumal sich herausgestellt hat, welch wirksame StrategieStrategie der interkomprehensive Ansatz für die Förderung von SprachlernkompetenzSprachlernkompetenz ist.
Bilinguale Bildungsgängebilinguale Bildungsgänge (BiLi) gelten wohl weltweit als ein Erfolgsmodell (Bonnet & Siemund 2018). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass zwei Sachfächer in einer anderen Sprache als der regulären (Deutsch) unterrichtet werden. Es handelt sich, wie gesagt, um Sachunterricht, der lehrseitig eine sachfachliche Kompetenz (nachgewiesen i.d.R. durch die Erste und Zweite Lehramtsprüfung im Sachfach) verlangt. Die sachfachlichen Lehr-/Lernergebnisse sind durchaus jenen des Fachunterrichts in der regulären Schulsprache vergleichbar. Absolventen dieses Bildungsgangs erreichen in der Zielsprache eine hohe Kompetenz (C1, C2 nach den GeR-Kompetenzdeskriptoren). Empirische Studien zum interkomprehensiv basierten Unterricht an Schülerinnen und Schülern dieses Bildungsganges belegen deren vorzügliche Eignung für den Weiterbau ihrer schon vorhandenen Mehrsprachigkeit. An diese Erfahrung knüpfen Angebote wie CertilinguaCertilingua an. Das Zertifikat erweitert den Nachweis des im bilingualen Bildungsgang erworbenen Kompetenzprofils auf eine weitere Fremdsprache, die auf dem Niveau B2 oder höher beherrscht wird (↗ Art. 111).
Im Grunde geschieht der Weiterbau der zielsprachlichen Kompetenz hier nach dem Grundsatz des schon in der Antike gelobten mnemotechnischen Prinzips rem tene, verba sequentur . Allerdings gilt auch für den regulären Fremdsprachenunterricht vor allem im Fortgeschrittenenbereich, dass sich das SprachenwachstumSprachenwachstum und Situationswissen an Inhalten ausbildet: je mehr desto besser.
2.3. Lebensweltliche Viel-/Mehrsprachigkeit: Sprachen – Kulturen – Identitätskonstruktionen
Wie Gogolins (1994) Formel des „monolingualen Habitus der deutschen Schule“ meint „lebensweltliche Mehrsprachigkeitlebensweltliche Mehrsprachigkeit“ keinen konkreten fremdsprachendidaktischen Ansatz, sondern eine Kontextbezeichnung, die aufgrund ihrer Beschaffenheit einen bestimmten didaktischen Zugriff verlangt. Dabei verbindet sie die soziale bzw. soziolinguistische Situation der Lerner, insbesondere von Kindern, mit definierten Lehr- oder Lernzielen. Beide Pole sind derweil an Viel- bzw. Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität festgemacht. Dabei sind Erst- und Zweitsprachen ebenso im Spiel wie Fremdsprachen. Vor allem mit den Erst- bzw. Familiensprachen und der Zweit- bzw. Umgebungs- oder Mehrheitssprache (Deutsch) ist auch ein Stück Identitätsbildung betroffen (↗ Art. 1).
Unsere europäischen Länder sind längst sowohl durch eine starke Einwanderung als auch durch eine rückläufige Entwicklung der angestammten Bevölkerungszahl gekennzeichnet. Eine erhebliche Verstärkung der aktiven Bevölkerung durch Immigration ist daher notwendig, schon um die sozialen Sicherungssysteme langfristig zu finanzieren bzw. zu erhalten (Meißner 2014). Hierauf müssen sich die betroffenen Gesellschaften und zuvorderst das Erziehungswesen einstellen. Auch vor diesem Hintergrund steht die Bewertung der etwa in Deutschland präsenten Einwanderer, ihrer Vielsprachigkeit und ihrer Identitätskonstruktion (↗ Art. 16)Migrantensprachen.
In den heimischen Varietäten (DialektDialekt), den MuttersprachenMuttersprache, Erstsprachen, den Zweitsprachen und in gewissem Umfang auch den Fremdsprachen verbinden sich die Kommunikationserlebnisse der Individuen mit deren SozialisationSozialisation. Nicht ohne Grund gelten sie als fundamental für die EnkulturationEnkulturation. Die sprachliche Bildung ruft daher nach Konzepten, wie unsere Gesellschaften mit der vorhandenen und der anzustrebenden VielsprachigkeitVielsprachigkeit umgehen sollen. Unbestritten ist, dass Migranten die Sprache der aufnehmenden Mehrheitsgesellschaft auf möglichst nativem Niveau erlernen sollen (sofern sie eine Integration in diese anstreben). Konkret verlangt eine plurale Gesellschaft zudem, dass Einwanderer, die ein Verbleiben in Deutschland anstreben, mittel- und langfristig die WerteWerte des GrundgesetzesGrundgesetz zur Richtschnur ihres Denkens und Handelns machen.
Die hohe Relevanz sprachlicher und (inter)kultureller Bildung für die Ausbildung einer plurireferentiellen Identität ist unbestritten. Sie bildet sich bei Einheimischen und Einwanderern aus den unterschiedlichen Erfahrungsräumen der Individuen. In diesem Zusammenhang wird oft folgender Mix genannt: lokal, regional, national, europäisch (Frankfurterin, Hessin, Deutsche, Europäerin). Die örtlichen Markierungen stehen neben anderen Zugehörigkeiten, die identitätsstiftend sein können, wie z.B. Beruf, Geschlecht, Generation und Alter, Religion, sexuelle Orientierung u.v.a.m. Aus diesen Zugehörigkeiten und Gruppenerlebnissen leitet sich positiv eine Steigerung der psychischen Befindlichkeit ( psychic income psychic incomeሴiሴ) her. Neben Pro-Zuordnungen sind auch Anti-Zuordnungen möglich: Wir-GruppenGruppen können sich also auch in latenter oder offener Gegnerschaft zu anderen Gruppen bilden. Gründe hierfür können etwa echte oder vermeintliche Frustrationen, Ängste und Ablehnung seinAblehnung. Das augenfälligste Beispiel hierfür liefert die XenophobieXenophobie.
2.4. Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenzen
Das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung verlangt interkulturelle Kompetenz, Fremdverstehen und Offenheit (Fäcke 2005). Es geht letztlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Émile Durkheim (1978) bezeichnete einen Zustand der sozialen Desintegration als AnomieAnomie. Er sah ihn in der Auflösung gültiger NormenNormen, moralischer Überzeugungen und Kontrollen bzw. des Wegfalls einer gemeinsamen Wertebasis in den frühindustriellen Gesellschaften seiner Zeit begründet. Als greifbare Folge machte er einen Anstieg der Kriminalität und der Suizidrate aus. Ursächlich erschien ihm ein Bruch zwischen den überkommenen Werten und den gängigen Praxen der realen Gesellschaft. So wie die frühe Industriegesellschaft im 19. Jh. religiöse Bindungen in Frage stellte, so führen heutzutage die Globalisierung und ihre praktischen Folgen viele Menschen zu einem Gefühl des Abgehängt-Seins; die Bewohner großer Teile Afrikas oder der Kriegsgebiete im Nahen Osten suchen sich in Europa ein Minimum an Sicherheit und Wohlstand. Beängstigend für einen großen Teil der hiesigen Mehrheitsbevölkerung ist die große Zahl der (potentiellen) Migranten.
Читать дальше