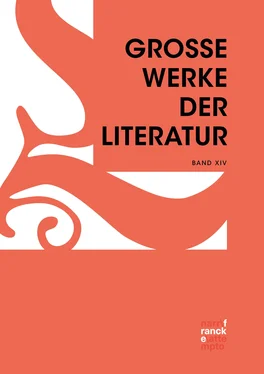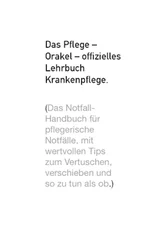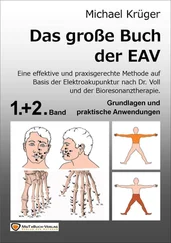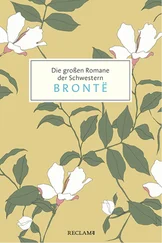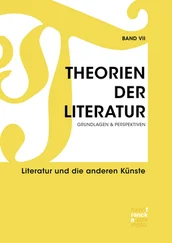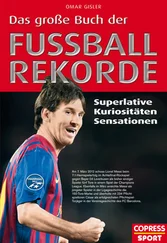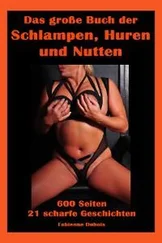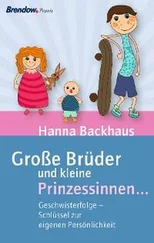Dass Mechthild sprachlich dabei von der höfischen Literatur geprägt ist, steht außer Zweifel. Das dürfte sie ihrer adligen Erziehung verdanken. So lässt sich zum Beispiel eine Nähe zur höfisch-ritterlichen Sprache konstatieren:
XVIII. Von des ritters strite mit vollen waffenen wider die begerunge
Ich bat fúr einen menschen, als ich was gebetten, das im got des lichamen beruͤrunge woͤlte benemen, das doch ane sûnde geschiht, des der boͤse wille da zuͦ nit bringet. Do sprach únser herre: »Swig! Behagete dir, das da ein ritter were mit vollen waffenen und von edeler kunst unde mit warer mankraft und mit geringen henden, das der lidig were und versumete sines herren ere und verlúre den richen solt und den edeln lobes schal, den beide, der herre und der ritter, in den landen behaben sol? Mere wa aber were ein ungetroierter man, der von ungerete nie ze strite kam – woͤlte der in fúrsten turneie komen, dem were schiere sin lip benomen. Darumbe muͦs ich der lúten schonen, die so lihte ze valle koment. Die lan ich striten mit den kinden, uf das si ein bluͦmenschappel ze lone gewinnin.« 30
Noch deutlicher ist die Nähe zum Bereich des Höfischen, wenn etwa der Hof selbst erwähnt wird oder im Bereich der höfischen Terminologie des Minnesangs. Dies zeigt sich etwa im Buch I,4:
IV. Von der hovereise der sele, an der sich got wiset
Swenne die arme sele kumet ze hove, so ist si wise und wol gezogen. So siht si iren got vroͤlichen ane . Eya, wie lieplich wirt si da enpfangen! So swiget si und gert unmesseklich sines lobes. So wiset er ir mit grosser gerunge sin goͤtlich herze. Das ist gelich dem roten golde, das da brinnet in einem grossen kolefúre. So tuͦt er si in sin gluͤgendes herze. Alse sich der hohe fúrste und die kleine dirne alsust behalsent und vereinet sint als wasser und win, so wirt si ze nihte und kumet von ir selben. Alse si nút mere moͤgi, so ist er minnesiech nach ir, als er ie was, wan im gat zuͦ noch abe. So sprichet si: »Herre, du bist min trut, min gerunge, min vliessender brunne, min sunne und ich bin din spiegel.« Dis ist ein hovereise der minnenden selen , die ane got nút wesen mag. 31
Dass Mechthilds Sprache dabei auch durch Kolonreime geprägt ist, hat Hans Neumann in seiner Edition auch optisch deutlich gemacht. Man muss insgesamt von einer Mischform zwischen Prosa und Lyrik ausgehen. Eine einzige Stelle dürfte reichen, um dies zu zeigen:
Do klagte si: »Owe herre, joch bist du mir alze lange vroͤmde; koͤnde ich dich, herre, mit zoͮfere gewinnen , das du nit moͤhtest geruͦwen denne an mir; eya, so gienge es an ein minnen ; so muͤstest du mich denne bitten, das ich fuͤre mit sinnen .« Do antwúrt er und sprach alsust: »O du unbewollen tube, nu goͤnne mir des, das ich dich muͤsse sparen ; dis ertich mag din noch nit enbern. « Do sprach si: »Eya herre, moͤhte mir das ze einer stunt geschehen , das ich dich nach mines herzen wúnsche moͤhte angesehen und mit armen umbevahen und din goͤtlichen minnelúste muͤsten dur mine sele gan, als es doch menschen in ertrich mag geschehen . Was ich da nach liden woͤlte, das wart nie von menschen oͮgen gesehen ; ja, tusent toͤde weren ze lihte. Mir ist, herre, nach dir also we! Nu wil ich in der trúwe stan; maht du es herre, erliden, so las mich lange jamerig nach dir gan. Ich weis das wol, dich muͦs doch, herre, der erste lust nach mir bestan .« 32
Die kurzen Beispiele der Kapitel XVII–XX aus Buch I können vielleicht zeigen, mit welcher Intensität Mechthild hier den Dialog zwischen der Seele und dem himmlischen Bräutigam gestaltet und welche sprachgewaltigen Sprachspiele sie dabei auch verwendet.
XVII. Die sele lobet got an fúnf dingen
O du giessender got an diner gabe, o du vliessender got an diner minne, o du brennender got an diner gerunge, o du smelzender got an der einunge mit dinem liebe, o du ruͦwender got an minen brústen, ane dich ich nút wesen mag!
XVIII. Got gelichet die selen fúnf dingen
O du schoͤne rose in dem dorne, o du vliegendes bini in dem honge, o du reinú tube an dinem wesende, o du schoͤnú sunne an dinem schine, o du voller mane an dinem stande, ich mag mich nit von dir gekeren.
XIX. Got liebkoset mit der sele an sehs dingen
Du bist min senftest legerkússin, min minneklichest bette, min heimlichestú ruͦwe, min tiefeste gerunge, min hoͤhste ere! Du bist ein lust miner gotheit, ein trost miner moͤnschheit, ein bach miner hitze!
XX. Dú sele widerlobet got an sehs dingen
Du bist min spiegelberg, min oͮgenweide, ein verlust min selbes, ein turm mines hertzen, ein val und ein verzihunge miner gewalt, min hoͤhste sicherheit! 33
Alois Haas hat anhand solcher und ähnlicher Wendungen des Textes deutlich gemacht, dass der mystische Diskurs, der hier literarische Autonomie und das Niveau der Poetizität gewinnt, paradoxerweise die Dimension der Alterität Gottes in poetische Formen gießt und die Grenze des Sagbaren gerade in der Poesie übersteigt, gleichzeitig auf die dichterische Sprache selbst und die Grenze des Sagbaren aufmerksam macht:34 „Unbeschadet der poetischen Autonomie und gewissermaßen sie bestätigend und gleichzeitig aufhebend wirkt“, so Haas,
das Moment der Transzendenz in der mystischen Aussage: Oft tritt es als Gebot des Schweigens auf, als mystische Sprachfeindlichkeit, die über dem Unsagbaren zu verstummen gebietet, oft aber auch als ein schwer zu bestimmender Mehrwert des Gesagten, als ‚Entrückung‘ des Sprechens selber, erkenntlich an ganz bestimmten Sprachformen wie Negation, Kontradiktion (Paradox), Superlation (‚über‘-Wendungen).35
Ingrid Kasten hat mit Blick auf das mystische Schweigen auf folgende, von sexueller Metaphorik geprägte Stelle hingewiesen:
So gat dú allerliebste zů dem allerschoͤnesten in die verholnen kammeren der unsúnlichen gotheit . Da vindet si der minne bette und minnen gelas, von gotte unmenschliche bereit . So sprichet únser herre: »Stant, vroͮwe sele !« »Was gebútest du, herre ?« »Ir soͤnt úch usziehen !« »Herre, wie sol mir denne geschehen ?« »Froͮw sele, ir sint so sere genatúrt in mich , das zwúschent úch und mir nihtes nit mag sin . […] Darumbe sont ir von úch legen beide vorhte und schame und alle uswendig tugent; mer alleine die ir binnen úch tragent von nature, (14v) der sont ir eweklich phlegen : Das ist úwer edele begerunge und úwer grundelose girheit ; die wil ich eweklich erfúllen mit miner endelosen miltekeit.« »Herre, nu bin ich ein nakent sele und du in dir selben ein wolgezieret got. Únser zweiger gemeinschaft ist das ewige lip ane tot .« So geschihet da ein selig stillinach ir beider willen . Er gibet sich ir und si git sich ime. 36
Ich zitiere Kasten:
Diese Stelle vermittelt einen Eindruck davon, mit welchen Mitteln Mechthild die Intensität und Direktheit der mystischen Liebeserfahrung sprachlich zum Ausdruck bringt. Das Schweigen, die Stille, erscheint hier nicht, wie bei Augustin und später noch bei Eckhart, als Voraussetzung für die Entrückung, sondern als deren Höhepunkt. Es markiert das Intimum, das Unaussprechliche, der Gotteserfahrung. Gelegentlich markiert Mechthild diese Grenze ausdrücklich, indem sie erklärt, der Genuß in der unio sei unsagbar (S. 264) und das allerliebeste müsse sie verschweigen (S. 258), sie macht ferner für die Bräute Christi das Recht geltend, darüber zu schweigen, was sie erfahren (S. 50). Schließlich verweist sie auch auf die Unzulänglichkeit der menschlichen Sprache, die göttliche Wahrheit zu kommunizieren (S. 166): „mich jamert des von herzen sere sid dem male, das ich súndig wip schriben muos, das ich die ware bekantnisse und die heligen erlichen anschouwunge nieman mag geschriben sunder disú wort alleine; sie dunkent mich gegen der ewigen warheit alze kleine.37
Читать дальше