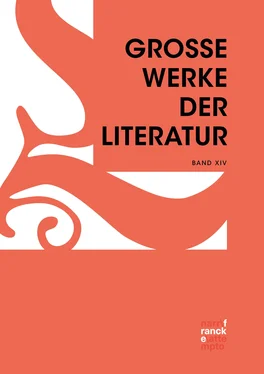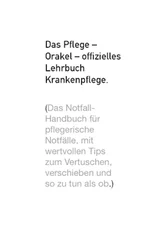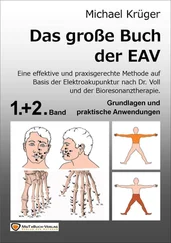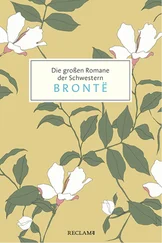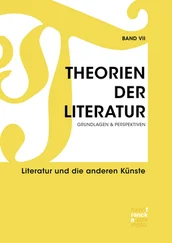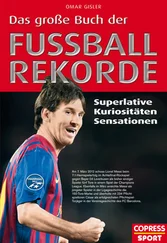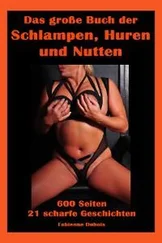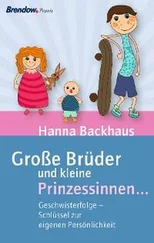Ruh hat diese drei Aspekte durch Umrisse einer theologischen Konzeption ergänzt, die sich weniger am mystischen Gehalt als vielmehr an der Theologie Mechthilds orientieren. Ruh geht davon aus, dass dabei erstens der trinitarische Gott und die Sicht darüber hinaus, zweitens die Heilsgeschichte und drittens die Betrachtung und Erwartung der Endzeit eine Rolle spielten.
So lässt sich mit Ruh zeigen, wie Mechthilds Gedanken vielfach um den dreieinigen Gott kreisen und wie dies zumeist in der bei ihr relativ selten vorkommenden direkten Vision geschieht.10 Entscheidend ist, dass Mechthild, wie etwas später dann auch Meister Eckhart, letztlich über die trinitarische Vorstellung hinausweist:
„Dem Bild der Engel vom dreieinigen Gott vor der Menschwerdung Christi geht nach Mechthilds Vorstellung ein anderes voran: die Gottheit vor der Schöpfung (VI 31, 26–31): ‚Wo war Gott, bevor er etwas geschaffen hat? Er war in sich selber, und ihm waren alle Dinge (im Geiste) gegenwärtig und offenkundig, so wie sie heute (geschaffen) sind. Welche Gestalt hatte damals unser Herrgott? Ganz so wie eine Kugel, und alle Dinge waren in Gott beschlossen ohne Schloß und ohne Tür. Der unterste Teil der Kugel ist die grundlose Festung über allen Abgründen, der oberste Teil ist eine Höhe, über die nichts hinausgeht, der Umfang der Kugel ist ein nicht zu umgreifender Kreis ( cirkel ).‘ Ruh deutet dies so: „Das Bild dieser intelligiblen Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist, das immer wieder in der platonisierenden Tradition auftaucht und bis auf Empedokles zurückgeführt wird, ist sicher ein theologischer Bildungssplitter. Das Erstaunliche ist, wie immer bei Mechthild, die Umformung ins Eigene. Die implizierte Offenheit der Kugel wird mit ‚ohne Schloß und Tür‘ konkretisiert, zum ‚nicht zu umgreifenden‘ Umfang tritt die Vorstellung eines ‚unten‘ und ‚oben‘: hier reicht sie ins Unendliche, dort ist sie Materie, organisierter Stoff der Welt.“
Dem besonders im dritten Buch geschilderten Ablauf der Heilsgeschichte mit ihrer extremen Vermenschlichung der göttlichen Personen folgt dann eine Konzentration auf die letzten Dinge, nämlich die Darstellung des Antichrist und der beiden Propheten Enoch und Elias, wobei diese Partien sich besonders in den Büchern IV und VI finden. Ruh hat Recht, wenn er darstellt, wie wichtig solche Partien für Mechthilds kirchliche Sendung, wie unwichtig sie aber für ihre mystische Spiritualität sind. Freilich hat Neumann mit Recht das Auftauchen auch subtiler theologischer Probleme bei Mechthild benannt:11 trinitarische Spekulationen in den Büchern II,3, III,9, und IV,14; die Erschaffung der Seele (I,22, III,9, VI,31); das Verhältnis von Seele und Leib während der Ekstase (VI,13) und die Rückkehr des Geschöpfs in den Schöpfer (VII,25). Diese Aufstellung einzelner theologischer Themen, wie sie Neumann vorgenommen hat, lässt sich durch eine generelle Bemerkung ergänzen: Für Mechthild von Magdeburg steht es außer Frage, dass sie mit ihrem Buch eigenhändiges Zeugnis ihrer mystischen Offenbarungen ablegt und für sie steht es, und dies wird im Buch II,26 besonders deutlich, stets außer jeder Frage, dass sie dabei im göttlichen Auftrag handelt. In diesem göttlichen Auftrag kann sie auch Prophezeiungen aussprechen, die eine scharfe Kritik der Kirche und kirchlicher Institutionen beinhalten. Buch VI,21 beispielsweise ist stark geprägt von einer Sichtweise, wie sie etwa Joachim von Fiore in seinen Prophezeiungen formuliert hatte. Mechthild spricht hier joachitisch geprägt eigene Prophezeiungen aus, die den Niedergang der Kirche, das Kommen des Jüngsten Gerichts und das Heraufdämmern eines eigenen Ordens der Jüngsten Brüder beschreiben:
XXI. Wie boͤsú pfafheit sol genidert werden, wie predier alleine predien soͤnt und beschoͤve sin und von den jungesten predieren
Owe crone der heligen cristanheit, wie sere bistu geselwet! Din edelsteine sint dir entvallen, wan du krenkest und schendest den heligen cristanen geloͮben; din golt das ist verfúlet in dem pfůle der unkúscheit , wan du bist verarmet und hast der waren minne nit; din kúscheit ist verbrant in dem girigen fúre des frasses; din diemůt ist versunken in dem sumpfe dines vleisches; din warheit ist ze nihte worden in der lugine dirre welte; din blůmen aller tugenden sint dir abegevallen.
Owe crone der heligen pfafheit, wie bistu verswunden! Joch hastu nicht mere denne das umbeval din selbes, das ist pfaͤffeliche gewalt, da mitte vihtestu uf got und sine userwelten vrúnde. Harumbe wil dich got nidern, e du icht wissest, wan únser herre sprichet alsus: »Ich wil dem babest von Rome sin herze ruͤren mit grossem jamere, und in dem jamere wil ich ime zůsprechen und klagen im, das minú schafhirten von Jerusalem mordere und wolve sint worden, wande si vor minen oͮgen die wissen lamber mordent, und die alten schaf dú sint allú hoͮbtsiech, wan sú (118v) moͤgent nit essen die gesunden weide, die da wahset an den hohen bergen, das ist goͤtlichú liebi und heligú lere. Swer den helleweg nit weis, der sehe an die verboͤsete pfafheit, wie rehte ir leben zů der helle gat mit wiben und mit kinden und mit andern offenbaren súnden. So ist des not, das die jungesten brůder kommen; wan swenne der mantel ist alt, so ist er oͮch kalt. So muͤs ich miner brut, der heligen cristanheit, einen núwen mantel geben.“ Das soͤllent die jungesten brůder wesen, als da vor ist geschriben.
„Sun babest, dis soltu vollebringen, so mahtu din leben lengen; das nu din vorvaren also unlange lebeten, das kumt da von, das si mines heimlichen willen nit vollebrahten.« Alsus sach ich den babest an sinem gebette, und do horte ich, das im got kúndete dise rede. 12
Auch vor Kritik am eigenen Stand der Beginen scheut Mechthild während ihrer Beginenzeit nicht zurück, so etwa wenn sie die Frage anspricht, mit welchen Tugenden man an der Eucharistie teilnehmen soll:
Die vil torehtigen beginen, wie sint ir also vrevele, das ir vor únserm almehtigen rihter nit bibenent, wenne ir gotz lichamen so dikke mit einer blinden gewonheit nemment! Nu ich bin die minste under úch, ich můs mich schemmen, hitzen und biben. 13
Auch als Nonne in Helfta spart sie beispielsweise im Kapitel VII,27 ( Wie der geistlich mensche sin herze sol keren von der welt ) nicht mit Kritik an den Klosterschwestern. Bei der Kritik spart sie sogar den Orden der Dominikaner, den sie sonst lobt, nicht aus:
Sant Dominicus der merkte sine bruͤder mit getrúwer andaht, mit lieplicher angesiht, mit heliger wisheit, und nit mit vare, nit mit verkerten sinnen und nit mit grúwelicher gegenwúrtikeit. Den wisen leret er fúrbas me, das er mit gotlicher einvaltekeit solte temperen alle sin wisheit; den einvaltigen lerte er die waren wisheit; den bekorten half er tragen heimelich alles ir herzeleit; die jungen lerte er vil swigen, da von wurden si uswendig gezogen und inwendig wise; die kranken und siechen troste er vil minneklich, und er bedahte oͮch alle ir not mit getrúwem vlisse. Si vroͤweten sich alle gemeine siner langen gegenwúrtekeit, und sin suͤssú geselleschaft mahte inen senfte alle ir kumberliche erbeit. Dirre orden was in den ersten ziten reine, einvaltig und dar zů vol der brennenden gottes liebi. Die reine einvaltekeit, die got einigen menschen git, die wirt gespottet von etlichen lúten, das er die gabe verlúret, da man die gotz wisheit inne vindet und kúset; das verloͤschet oͮch gotz brennende minne. […] Das man die brůdere ze sere tribet ane erbarmherzekeit und ane suͤsse lere, da von geschehent schedelichú ding, der ich nu muͤs swigen. 14
Noch schärfer freilich formuliert Mechthild ihre Kritik am Domkapitel:
Das got die tůmeherren heisset boͤke, das tůt er darumbe, das ir vleisch stinket von der unkúscheit in der ewigen warheit vor siner heligen drivaltekeit. 15
Читать дальше