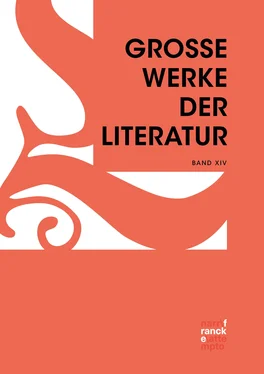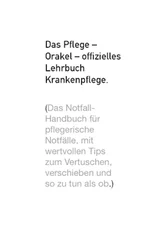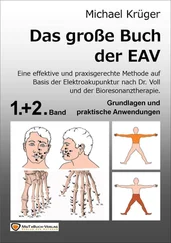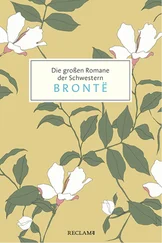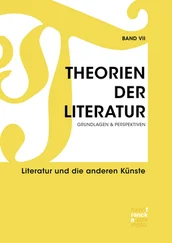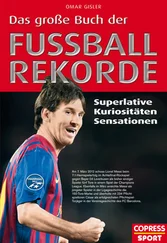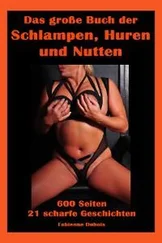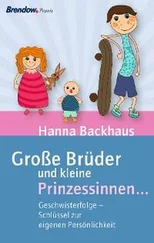Gewiß steht hinter der Metaphorik des Fließens, sich Ergießens, des Wassers, des Brunnens neben den biblischen ‚Vor-Bildern‘ auch der Emanatismus des Pseudo-Dionysius Areopagita sowie die neuplatonische Lichtmetaphysik neben den jüdisch-christlichen Vorstellungen vom göttlichen Brunnen, Licht und Feuer.3
Alois Haas hat, wegweisend, Mechthilds Titel so interpretiert:
Die Einsicht, daß Gott Licht ist, ist so traditionell neuplatonisch wie christlich. Für die mittelalterliche Ästhetik ist die Lichtmetaphysik schlechterdings grundlegend, […] Gott ist in einem unmetaphorischen Sinne Licht; er ist Licht, er erscheint nicht nur so. Theophanien ereignen sich daher stereotyp in Form von Lichtphänomenen. Auch bei Mechthild. Aber – und hierin wendet sie sich gegen die gesamte Tradition – sie setzt den Akzent nicht auf das zum Licht triebhaft emporhastende Geschöpf, sondern das Licht wird in seiner Qualität des Verströmens gefaßt; es ist ein vliessende lieht miner gotheit, in allú die herzen die da lebent ane valscheit (Einleitung). Die Figur des Aufstiegs wird in die des göttlichen Abstiegs verkehrt: […] die Selbstvernichtigung Gottes in der Menschwerdung wird zur Erscheinung herabfließenden Lichts.4
Auf die Metapher des Fließens wird noch einzugehen sein. Hier stellt sich zunächst die Frage, woher Mechthild über diese Metaphorik – auch wenn sie nach Haas gar keine ist – verfügte. Für Neumann, Ruh und andere war klar, dass Mechthild aus verschiedenen Quellen, wahrscheinlich unterwiesen durch Ordenspriester wie ihren Beichtiger Heinrich von Halle, auf diese Terminologie und diese Topoi gestoßen war und dass sie auf diese Weise Dinge und Texte kennengelernt hatte, die sie in ihren Visionen und Betrachtungen, Dialogen und gedanklichen Erörterungen frei verwerten konnte. Anders als bei Hadewijch aber sei für Mechthild, so Neumann, wegen ihrer mangelnden Lateinkenntnisse und ihrer mangelnden theologischen Bildung eine Vermittlung durch Bücher in der lateinischen Kirchensprache ausgeschlossen. Es sei dagegen nicht unwahrscheinlich, dass Mechthild Anregungen aus Schriften der älteren mittelniederländischen Frauenmystik erhalten habe.5 So gesehen passt ihre Béguinage und ihre spätere Tätigkeit im Kloster Helfta in dieses Bild, denn schon im Beginenhaus kann sie mit Texten in Berührung gekommen sein, die diese mittelniederländische Frauenmystik rezipiert und vermittelt haben könnten.
Das Werk lässt sich mit Neumann grob so gliedern:1
In den ersten beiden Büchern treten besonders die „Wechselgesänge zwischen der Seele und Gott“ und die „Dialoge über Wesen und Wirkung der Minne“ hervor. Dabei stehen „brautmystische Vorstellungen und Minneklagen im Vordergrund, oft im Anklang an das Hohelied, an den frühen Minnesang oder an volkstümliche Lieddichtung.“ Seit dem dritten Buch werden einfache Visionsberichte über Himmel, Fegefeuer und Hölle sowie verschiedene Lehrdialoge mit Gott und verschiedene Minnebetrachtungen häufiger. Im siebten Buch ist dann die wieder stärker hervortretende Brautmystik kein Ausdruck der Minneekstase mehr, sondern Zeugnis der Unioerwartung nach dem Tod.
Alois Haas hat einen etwas anderen Gliederungsansatz versucht und dargestellt, wie sich die Mechthild’sche Mystik in insgesamt drei Aspekten gliedern lasse: Der erste Aspekt betreffe die Unmittelbarkeit der mystischen Vereinigung der Seele mit Gott; der zweite die Entfremdung der Seele zu Gott; der dritte die dialektische Versöhnung beider im Konzept der sinkenden Demut und Liebe.2
Zum ersten dieser Aspekte (Vereinigung) hält Haas fest: „Mechthilds Mystik ist affektive Liebesmystik, in der die gnadenhafte Vereinigung von Gott und Seele durch das Personal von Bräutigam und Braut und entsprechende erotische Symbolik vergegenwärtigt wird.“3 Dafür gibt Haas ein anschauliches Beispiel aus Mechthilds Werk:
| 1 |
Herre, nu bin ich ein nakent sele, Und du in dir selben ein wolgezieret got. Únser zweiger gemeinschaft Ist der ewige lip ane tot. |
| 5 |
So geschihet da ein selig stilli Nach ir beider willen. Er gibet sich ir und si git sich ime. Was ir nu geschehe, das weis si, Und des getroeste ich mich.4 |
Auf den ersten Blick verwirrend ist der Gebrauch der Pronomina, wenn in den Zeilen 1–4 die Seele zu Gott spricht und in den Zeilen 5–9 ‚Mechthild‘ über ihre Seele und Gott. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass gerade so – im Sinn einer Einheitsmystik – Differenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Person, Seele und Gott verwischt werden.
Der zweite von Haas benannte Aspekt besteht in einer Entfremdung oder in einer Gottesferne, die freilich bewusst angenommen wird; etwa wenn die Seele gerade die Leiderfahrung in der Gottesferne überschwänglich begrüßt:
Siest willekomen, vil selig vroemedunge! Wol mir, das ich ie geboren wart, da du, vrouwe, nu min kamererin solt sin, wan du bringest mir ungewone vroede und unbegriffenlich wunder und darzuo untreglich suessekeit! Aber, herre, die suessekeit solt du von mir legen und la mich din vroemedunge han! 5
Eya, selige gotzvroemedunge, wie minnenklich bin ich mir dir gebunden? Du stetigest minen willen in der pine und liebest mir die sweren, langen beitunge in disem armen libe. Swa mitte ie ich mich zuo dir geselle, got ie grossor und wunderlichor uf mich vallet. O herre, ich kan in der tieffi der ungemischeten diemuetikeit nit entsinken.
Ouwe, ich dir in dem homuote lihte entwenke.
Mere: ie ich tieffer sinke,
ie ich suessor trinke. 6
Die Bewegung der Einheit erfolgt dabei, wie Haas betont, weniger vom Individuum zu Gott als vielmehr von Gott zur menschlichen Seele hin. Notwendig dafür ist der dritte, von Haas benannte Aspekt, der Aspekt der sinkenden Liebe. Damit die Liebe Gottes in den Menschen sinken oder hinabfließen kann, bedarf es freilich sowohl der göttlichen als auch der menschlichen Demut. Mechthild bringt dies im Buch II ins Wort, wenn sie Gott so sprechen hört:
Wa ich je sunderliche gnade gap, da sůchte ich je zů die nidersten, minsten, heimlichosten stat; die irdenschen hohsten berge moegent nit enpfan die offenbarunge miner gnaden, wan die vluot mines heligen geistes vlússet von nature ze tal. 7
Susanne Köbele hat für Mechthilds Kennzeichnung dieses Bild des Flusses gewählt, ist aber dessen Fließrichtung von oben nach unten gefolgt und hat damit auch die Bedeutung der Demut erfasst;8 das wird besonders an dem von Köbele gewählten Textausschnitt evident, wo Gott Mechthild verkündet, er wähle sich für seine Offenbarung die niederste und geringste Stätte:
[…] wan die vlůt mines heligen geistes vlússet von nature ze tal. Man vindet manigen wisen meister an der schrift, der an im selber vor minen oͮgen ein tore ist. Und ich sage dir noch me: Das ist mir vor inen ein gros ere und sterket die heligen cristanheit an in vil sere, das der ungelerte munt die gelerte zungen von minem heligen geiste leret.
Hier, so Köbele, werde ein „ungelehrtes Charisma“ beschworen, und damit liege hier eine „Schlüsselstelle für das Selbstverständnis der Autorin“ vor. Mechthild setze „ihr Nicht-Wissen […] der schulwissenschaftlichen Theologie selbstbewusst gegenüber“. Dem Meister der – lateinischen – Schrift trete mit Mechthild die ‚Laienautorin‘ gegenüber. „Die Niedrigkeit der Volkssprache qualifiziert diese […] in besonderer Weise für die mystische Offenbarung.“9
Halten wir also noch einmal die drei von Haas benannten Aspekte Mechthilds fest: Einerseits die Unmittelbarkeit der mystischen Vereinigung der Seele mit Gott, andererseits die Entfremdung der Seele zu Gott, und schließlich die dialektische Versöhnung beider im Konzept der sinkenden Demut und Liebe.
Читать дальше