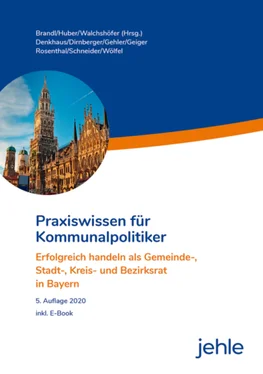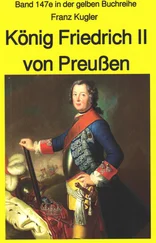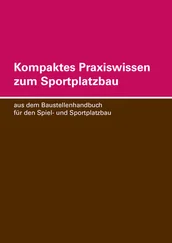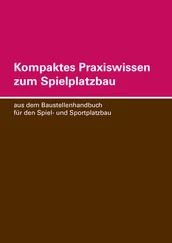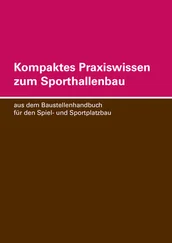Man unterscheidet zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handlungsformen. Bei privatrechtlichen Handlungsformen stehen sich in der Regel natürliche oder juristische Personen des Privatrechts gegenüber. Typische Form des privatrechtlichen Handelns ist der Abschuss oder die Auflösung eines Vertrages. Es ist wichtig zu wissen, ob ein privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Akt vorliegt, denn davon hängt der Rechtsweg ab, also die Frage, ob ein Verwaltungsgericht oder ein Zivilgericht zuständig ist.
Geregelt in § 35 Abs. 1 BauGB. Privilegierte Vorhaben sind im Außenbereich unter erleichterten Voraussetzungen zulässig, nämlich dann, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. Zu den privilegierten Vorhaben gehören beispielsweise Vorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen. Auch Windenergieanlagen werden in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genannt. Allerdings hat Bayern von einer Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht und in Art. 82 BayBO geregelt, dass entsprechende Anlagen nur dann privilegiert sind, wenn sie zu Wohnbebauung einen Mindestabstand des 10fachen ihrer Höhe einhalten (10 H-Regelung).
In § 35 Abs. 4 BauGB werden darüber hinaus Vorhaben genannt, bei denen bestimmte – in der Praxis jedoch häufig tangierte – Belange bei der Beurteilung ausgespart bleiben. Dies nähert diese Vorhaben an die privilegierten Vorhaben an; häufig spricht man deshalb von „teilprivilegierten Vorhaben“. Die Vorhaben des § 35 Abs. 4 BauGB knüpfen an eine bestehende oder zumindest vorhanden gewesene Bausubstanz an. Erfasst werden unter sehr genau geregelten Voraussetzungen z. B. Umnutzungen ehemals landwirtschaftlich genutzter Gebäude, Ersatzbauten sowie Erweiterungen von vorhandenen Wohngebäuden oder Gewerbebetrieben.
Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ besteht die Möglichkeit der Einrichtung eines Verfügungsfonds zur Förderung von öffentlich-privaten Vorhaben innerhalb des Projektgebietes. Der Fonds finanziert sich zu mindestens 50 % von privater Seite. Der öffentliche Anteil wird durch staatliche Mittel bereitgestellt.
Die Mittel eines Jahresbudgets können für Investitionen sowie investionsvorbereitende und investionsbegleitende Maßnahmen verwendet werden. Nichtinvestive Projekte können Mittel erhalten, die nicht aus der Städtebauförderung stammen. Anträge können von Einzelpersonen, Unternehmen, Verbänden, Vereinen etc. gestellt werden. Über die Bewilligung entscheidet eine örtliche Lenkungsgruppe.
Public-Private-Partnership
Öffentliche-Private-Partnerschaften (= Public-Private-Partnerships kurz PPP) sind Partnerschaften der öffentlichen Hand mit der Wirtschaft und/oder privaten Akteuren. Sie bezeichnen das Zusammenwirken von Staat und der privaten Wirtschaft bei Vorhaben, die einen entwicklungspolitischen Nutzen erbringen und gleichzeitig im Interesse der beteiligten Privatunternehmen liegen. Grundvoraussetzung ist ein beiderseitiges Interesse an dem Erfolg des Projektes (Beispiel: Bau Elbphilharmonie).
Qualifizierter Bebauungsplan
Geregelt in § 30 Abs. 1 BauGB. Er enthält mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, über die überbaubare Grundstücksflächen und über die örtliche Verkehrsflächen. Er setzt abschließendes Baurecht. Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans sind Vorhaben zulässig, wenn sie den Festsetzungen nicht widersprechen und die Erschließung gesichert ist.
Rat der Europäischen Union
Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat oder Rat) ist gemeinsam mit dem Europäischen Parlament der Gesetzgeber der EU. Der Rat setzt sich aus den Vertretern jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene zusammen. Je nach behandeltem Thema kommen die Minister unterschiedlicher Ressorts zusammen.
Das Ratsbegehren ist der Beschluss des Gemeinderates oder des Kreistages, eine bestimmte Frage im Wege eines Bürgerentscheides entscheiden zu lassen (Art. 18a Abs. 2 GO; Art. 12a Abs. 2 LKrO). Der Gemeinderat bzw. Kreistag verzichtet damit darauf, in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.
Geregelt in § 3 Nr. 2 ROG und § 1 Abs. 4 BauGB. Die Gemeinde hat ihre Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Regionalplänen oder im Landesentwicklungsprogramm. Ziele der Raumordnung können daher nicht abgewogen werden; zu beachten ist jedoch, dass auch Ziele häufig noch Konkretisierungsspielräume enthalten, die die Bauleitplanung nutzen darf. Nicht Ziele der Raumordnung in diesem Sinne – und daher nur Abwägungsmaterial – sind die Grundsätze der Raumordnung nach § 3 Nr. 3 ROG oder landesplanerische Beurteilungen aufgrund eines Raumordnungsverfahrens.
Staatliche Aufsicht kontrolliert bei der Erfüllung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis nur die Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns.
Rechtsmittel nennt man die Maßnahme, mit der man sich gegen eine Entscheidung oder einen Rechtsakt zur Wehr setzt oder ihn überprüfen lässt. Widerspruch, Klage und Berufung sind förmliche Rechtsmittel. Aufsichtsbeschwerde und Dienstaufsichtsbeschwerde sind formlose Rechtsmittel, die weder an eine Frist noch an eine Form gebunden sind.
Die Gesamtheit der geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, Verordnungen, Satzungen und sonstigen Regelungen, die unsere Gesellschaft prägen und die allgemeine Gültigkeit besitzen, bilden die Rechtsordnung.
Ein Staat, der von seiner Verfasstheit die Bindung an Recht und Gesetz vorgibt und die Einhaltung dieser Ordnung auch überwacht. Wesentliches Kennzeichen eines Rechtsstaates ist eine strikte Gewaltenteilung, Presse- und Meinungsfreiheit sowie Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der Justiz.
Regiebetriebe sind organisatorisch und rechtlich unselbstständige Einrichtungen innerhalb der allgemeinen Kommunalverwaltung. Ein Regiebetrieb kann den Vorschriften über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebeunterworfen werden, wenn er als Sondervermögen geführt wird (sog. optimierter Regiebetrieb).
Geregelt in § 3 BauNVO. Das reine Wohngebiet (WR) ist ein Baugebietstyp der BauNVO, der als Art der baulichen Nutzung in einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann. Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen. Bei Festsetzung eines reinen Wohngebiets sollte sich die Gemeinde bewusst sein, dass außer Wohngebäuden fast keine anderen Nutzungsarten zulässig sind – ein recht unflexibles Instrument also.
Das Reklamationsrecht ist ein Recht einer Minderheit, die Entscheidung eines beschließenden Ausschusses überprüfen zu lassen. Es steht dem ersten Bürgermeister oder seinem Stellvertreter im Ausschuss, einem Drittel der Ausschussmitglieder oder einem Viertel der Gemeinderatsmitglieder zu. Sie können innerhalb von einer Woche nach dem Tag der Beschlussfassung beantragen, die betreffende Angelegenheit im Plenum erneut zur Abstimmung zu stellen. Entscheidungen beschließender Ausschüsse werden deshalb erst nach Ablauf einer Woche rechtswirksam. Mit dem Antrag auf Nachprüfung wird ein Ausschussbeschluss gegenstandslos.
Читать дальше