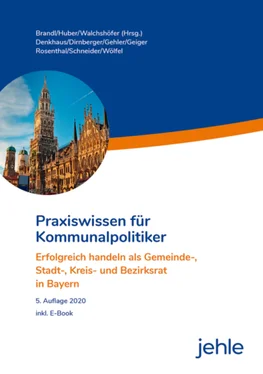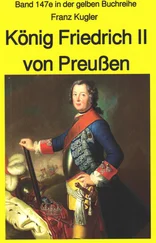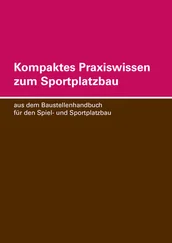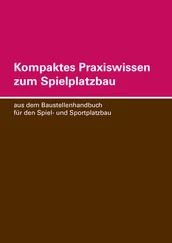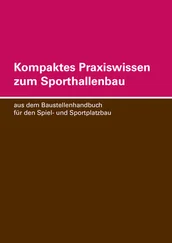Geregelt in Art. 81 BayBO. In dieser Vorschrift findet sich eine Reihe von Ermächtigungsgrundlagen, auf Grund derer die Gemeinde örtliches Satzungsrecht schaffen kann.
Wichtige Beispiele sind Gestaltungssatzungen oder Stellplatzsatzungen. Gemäß Art. 81 Abs. 2 BayBO und § 9 Abs. 4 BauGB können die örtlichen Bauvorschriften auch Bestandteil eines Bebauungsplans sein.
Geregelt in § 13b BauGB. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB (siehe dort) ist entsprechend anwendbar für Bebauungspläne, die im Anschluss an eine bestehende Bebauung aufgestellt werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass durch diesen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet werden soll. Außerdem darf die in dem Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche nicht mehr als 10.000 m² betragen. Die Regelung ist befristet bis zum 31.12.2019; bis zu diesem Zeitpunkt muss der Aufstellungsbeschluss gefasst sein, bis zum 31.12.2019 muss dann der Satzungsbeschluss vorliegen.
Online-Initiativen/Online-Plattformen (lokale)
Lokale Initiativen (z. B. Werbegemeinschaft, City-Management, Wirtschaftsförderung, sonstige Händler- oder Gastrozusammenschlüsse etc.) entwickeln verstärkt kollektive Online-Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der einzelnen Unternehmen. Im Resultat werden häufig alle Angebote über eine gemeinsame Online-Plattformen mit lokalem oder regionalem Fokus gebündelt dargestellt. Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, aktuelle Angebote, aber auch Tipps für städtische Veranstaltungen sind der Standard dieser Websites. Die Online-Sichtbarkeit der Unternehmen steht dabei im Fokus. Stärker ausdifferenzierte Plattformen bieten auch Shopfunktionen an. Die weitere Marktentwicklung ist aufgrund der rasanten digitalen Entwicklung schwer abschätzbar.
Das OZG wurde 2017 verabschiedet. Es legt den Behörden von Bund, Ländern und Kommunen auf, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch online anzubieten und hierfür entsprechende Portale und Zugangsmöglichkeiten zu schaffen.
Ein wichtiger Begriff der Ermessensausübung. Im Rahmen der Gesetzmäßigkeit kann die Verwaltung selbst entscheiden, ob ein hoheitliches Handeln im konkreten Fall nötig ist. Verhängt der Polizist eine Geldbuße oder belässt er es bei einer mündlichen Verwarnung.
Beim Outsourcing bedient sich die Kommune bei der Erfüllung ihrer Aufgaben privater Dritter. Dabei handelt es sich im Regelfall um Leistungen, die nicht zum Kernbereich der jeweiligen Aufgabe gehören, sondern lediglich die eigentliche Aufgabenerfüllung unterstützen sollen (z. B. Reinigung des Rathauses, Wäscherei in einem Krankenhaus, EDV-Betreuung).
Im Gegensatz zur materiellen Privatisierung kommunaler Aufgaben bleibt die Kommune Aufgabenträger.
Panaschieren nennt man die Möglichkeit des Wählers, die zu vergebenden Stimmen auf mehr als einen Wahlvorschlag zu verteilen.
Partizipation/Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Planungsprozesse. Sei es durch Gesetze, Richtlinien der Förderprogramme, dem wachsenden Erfordernis privaten Engagements, aufgrund mangelnder finanzieller Spielräume der Kommunen oder durch die steigende Erwartungshaltung unserer Gesellschaft nach direkter Demokratie. Sie ist aber auch einer der größten Kostentreiber in Planungsprozessen und kann unerfüllbare Erwartungshaltungen wecken. Eine an die Fragestellung und die lokalen Beteiligungsbedingungen angepasste Methodenauswahl ist unerlässlich, um effiziente und erfolgreiche Resultate zu erzielen.
Zu unterscheiden ist die formelle (z. B. in der Bauleitplanung) und informelle (z. B. im Stadtmarketing) Bürgerbeteiligung.
Personalhoheit ist das von der Selbstverwaltung umfasste Recht, eigenes Personal zu beschäftigen und Personalausstattung sowie -struktur zu formen.
Das ist der laufende und strategische Prozess, den Personalbestand anzupassen und zu strukturieren. Zur Personalplanung gehört im weiteren Sinn auch die Organisationsplanung, denn neue Aufgaben erfordern in der Regel anders strukturierten oder neuen Personaleinsatz. Personalplanung ist eine strategische Planung, für die der jeweilige Leiter einer Behörde zuständig ist.
Darunter versteht man die eigenen personenbezogenen Fähigkeiten, Interessen und Eigenschaften.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Ist das Recht für jedermann sich mit Beschwerden an Behörden, Dienststellen oder die Volksvertretung (Landtag, Bundestag, Gemeinderat) zu wenden. Die Petition ist ein formloser, verfassungsrechtlich verankerter Rechtsbehelf, vgl. Art. 115 BV, Art. 17 GG.
Ihre Erledigung ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben.
Geregelt in § 33 BauGB. Bereits während des Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan können unter bestimmten Voraussetzungen auf seiner Grundlage bereits Baugenehmigungen erteilt werden, insbesondere wenn der Entwurf planreif ist. Dabei unterscheidet man die formelle Planreife (= die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist durchgeführt und die Behörden sind nach § 4 BauGB beteiligt worden) und die materielle Planreife (= es ist davon auszugehen, dass der Bebauungsplanentwurf in seiner jetzigen Gestalt beibehalten werden wird).
Das Plebiszit ist eine Abstimmung, bei der die stimmberechtigten Bürger selbst eine Entscheidung über Sachfragen herbeiführen (Volksabstimmung). Im Staatsrecht ist das Plebiszit ein Merkmal der unmittelbaren (direkten) Demokratie. Das Plebiszit steht im Gegensatz zur Repräsentation.
Pluralismus ist ein Strukturprinzip der Gesellschaft, wonach eine Vielzahl von einzelnen sozialen Gruppen gleichberechtigt nebeneinander innerhalb einer verfassten (staatlichen) Gemeinschaft existieren und wirken.
Jeder kann unabhängig von einer eigenen Rechtsverletzung die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes rügen und damit einer gerichtlichen Überprüfung zuführen. Vgl. Art. 98 IV BV.
Der „Portalverbund“ ist eine technische Verknüpfung der Verwaltungsportale von Bund und Ländern, über den der Zugang zu Verwaltungsleistungen auf unterschiedlichen Portalen angeboten wird.
Dienst des Freistaats Bayern für die sichere Kommunikation der Behörden mit dem Bürger. Der Freistaat Bayern stellt den Kommunen diesen Postfach-Dienst dauerhaft betriebskostenfrei zur Verfügung. Dienst wird z. T. auch als „Postkorb“ bezeichnet.
Privatisierung ist die Übertragung von öffentlichen Aufgaben an einen privaten Rechtsträger. Von unechter Privatisierung spricht man, wenn der neue, privatrechtlich organisierte Aufgabenträger (z. B. eine städtische Wohnungsbaugesellschaft) zu 100 % im Eigentum der Kommune steht, von echter Privatisierung, wenn ein tatsächlich personenverschiedener privater Akteur auftritt.
Privatrechtliches Handeln
Читать дальше