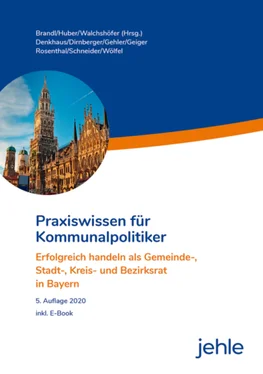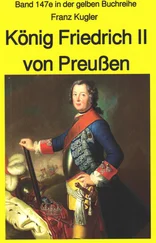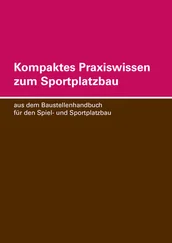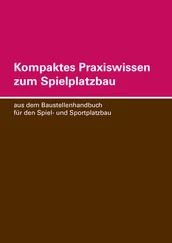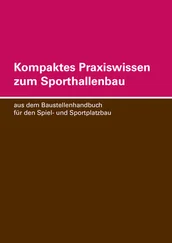Geregelt in § 35 Abs. 6 BauGB. Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Dadurch, dass diese wichtigen öffentlichen Belange gleichsam ausgeblendet werden, schafft die Außenbereichssatzung die grundsätzliche Möglichkeit, Splittersiedlungen im Außenbereich nach innen zu verdichten.
Kann vorübergehend zur Förderung aller Aktivitäten für einen bestimmten Bereich und in einem festgelegten Zeitraum (Monate, Jahre) eingerichtet werden. Die Verantwortlichen im „Management auf Zeit“ übernehmen dabei vor Ort die Schnittstellenfunktion zwischen privater und öffentlicher Hand und koordinieren die Zusammenarbeit.
Typisches Beispiel ist das Innenstadt- oder Quartiersmanagement, das die dortige Attraktivitätssteigerung verfolgt. Das Management auf Zeit steuert als Motivator und Ideengeber die Zusammenarbeit und setzt in einem dialogorientierten Prozess gemeinsame Ziele und Maßnahmen um bzw. entwickelt diese neu.
Mandatsträger nennt man die gewählten Mitglieder der jeweiligen Kommunalparlamente, also die Mitglieder des Stadtrates, Gemeinderates, Kreistages bzw. Bezirkstages. Vgl. Teil 3 2.1.
Der allgemeine Standortwettbewerb und die zunehmende Professionalisierung kommunaler Handlungen erfordern klare Abgrenzungen. Dies kann durch die Aufstellung einer Marke, als Ergebnis eines Markenbildungsprozesses vor Ort gelingen. In diesem Prozess werden Differenzierungs- und Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet und mit passenden, umsetzungsorientierten Maßnahmen aus den Bereichen Kommunikation und Werbung, aber auch Stadtmarketing- und sogar Stadtentwicklung unterlegt. Die Marke hilft dabei als wichtige Leitplanke zur Ausrichtung jeglichen außenwirksamen Handelns.
In diesem Zusammenhang werden auch häufig die Begriffe Profilierung, Positionierung, Branding und/oder Dachmarke verwendet.
Maß der baulichen Nutzung
Geregelt in § 16 ff. BauNVO. Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung bestimmt werden durch Festsetzung der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen, der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, der Baumassenzahl oder der Baumasse, der Zahl der Vollgeschosse oder der Höhe der baulichen Anlagen. Ein Bebauungsplan, der das Maß der baulichen Nutzung regelt, muss mindestens Festsetzungen über die Grundflächenzahloder die Größe der Grundfläche sowie regelmäßig über die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen enthalten.
Durchgängig elektronische Kommunikation. Ist bei der Verarbeitung der Information ein Übergang auf ein anderes Medium (z. B. Papier) erforderlich, liegt hierin ein Medienbruch.
Die Mehrheitswahl ist eine Persönlichkeitswahl. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei der sog. relativen Mehrheitswahl gilt die jeweils höchste Stimmenzahl bzw. gelten die höchsten Stimmenzahlen. Bei der sog. absoluten Mehrheitswahl muss der Kandidat die absolute Mehrheit, also mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen erreichen.
Metadaten bzw. Metainformationen sind strukturierte Daten, die Informationen über andere Informationsressourcen enthalten („Daten über Daten“).
Fähigkeit, Arbeitstechniken zur Lösung, Kontrolle und Durchführung von Problemen zu erkennen und anzuwenden.
Geregelt in § 6 BauNVO. Das Mischgebiet (MI) ist ein Baugebietstyp der BauNVO, der als Art der baulichen Nutzung in einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Auch hier muss die Durchmischung von Wohnen und Gewerbe wirklich gewollt sein. Die Festsetzung eines MI als Puffer zwischen einem Gewerbegebiet und einem Wohngebiet ist regelmäßig unter dem Gesichtspunkt des Etikettenschwindels problematisch und führt nicht selten zu erheblichen Schwierigkeiten in der Umsetzung.
Auch Cross- oder Omni-Channeling genannt. Bezieht sich darauf, dass im Einzelhandel mittlerweile die Kombination aus klassischer Offline-Werbung mit Online-Marketing als Voraussetzung gilt, um Kunden zu erreichen und Produkte sowohl im Laden als auch im Netz erfolgreich zu verkaufen.
Wenn die Abweichungen vom Haushaltein solches Gewicht annehmen, dass sie das ursprüngliche Haushaltsbild entscheidend verändern, dann ist nach Art. 68 GO ein Nachtragshaushalt aufzustellen.
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) hat im Jahre 1993 unter dem Oberbegriff „Neues Steuerungsmodell“ eine Reihe von Maßnahmen der Verwaltungsreform zusammengefasst und miteinander verknüpft. In einem „Bauplan“ der Verwaltung setzt die KGSt u. a. auf klare Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Verwaltung, Führung durch Absprachen und Vereinbarungen, Delegation, zentrale Steuerung mit Controlling und Berichtswesen sowie Wettbewerb zwischen Kommunen oder Einrichtungen innerhalb einer Kommune. Später wurde das Modell zum Kommunalen Steuerungsmodell weiterentwickelt.
Der Erlass und die Vorbereitung eines Gesetzes durch das zuständige Legislativorgan wir normsetzendes Handeln genannt.
Öffentliche Ausschreibung
Die Öffentliche Ausschreibung ist eine Verfahrensart im Vergabewesen. Sie fordert in einem förmlichen Verfahren einen unbeschränkten Kreis von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf.
Geregelt in § 35 Abs. 3 BauGB. Die öffentlichen Belange sind entscheidend bei der Beurteilung von Außenbereichsvorhaben. Privilegierten Vorhaben dürfen die öffentlichen Belange nicht entgegenstehen, sonstige Vorhaben dürfen öffentliche Belange nicht beeinträchtigen. Wichtige öffentliche Belange sind insoweit beispielsweise die Darstellungen eines Flächennutzungsplans, die Belange der natürlichen Eigenart der Landschaft sowie die Befürchtung der Entstehung, der Verfestigung oder der Erweiterung einer Splittersiedlung. Die in § 35 Abs. 3 BauGB enthaltene Aufzählung ist nicht abschließend, spricht aber die in der Praxis wichtigsten Belange an.
Um Verständnis und Anerkennung für die eigenen Anliegen und Interessen zu fördern, den Bekanntheitsgrad zu steigern, ein eigenständiges Erscheinungsbild zu schaffen und eine Vertrauensbasis gegenüber der Öffentlichkeit aufzubauen, werden durchgeplante Kommunikationsmaßnahmen an die Öffentlichkeit gebracht. Beispiele: Pressekonferenzen und -mitteilungen, website, Info-Blog (siehe auch Kommunikation extern). Wichtig dabei: vorausschauend agieren und heikle Themen antizipieren, um diese rechtzeitig auffangen zu können.
Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die über das Gemeindegebiet nicht hinausgehen.
Читать дальше