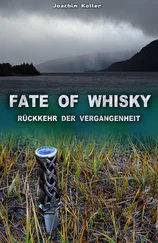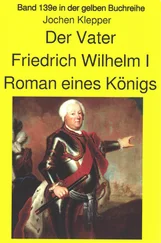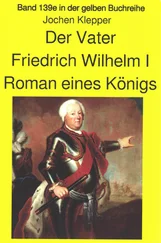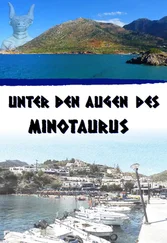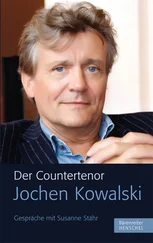2.8 Pharyngeale Kontraktion
Der Pharynxschlauch besteht aus drei Pharynxkonstriktoren, dem M. constrictor pharyngeus superior, dem M. constrictor pharyngeus medius sowie dem M. constrictor pharyngeus inferior. Der obere Pharynxkonstriktor, auch als »Passavant‘scher Wulst« bezeichnet (  Abb. 6.25), bildet gemeinsam mit dem Gaumensegel den velopharyngealen Abschluss. Der untere Konstriktor bildet gemeinsam mit dem M. cricopharyngeus den oberen Ösophagussphinkter, der daher auch »pharyngo-ösophageales Segment« genannt wird und hebt dabei auf die anatomisch-funktionelle Einheit dieser Muskeln ab 2 . Die kontinuierliche Kontraktion dieser Muskeln, die am Bolusende beginnt, übt einen weiteren Schub auf den Bolus aus. Ist diese Kontraktion, beispielsweise aufgrund einer neurogen bedingten pharyngealen Schwäche, beeinträchtigt, kommt es zu einer unvollständigen Bolusaustreibung und damit ebenfalls zu Residuen, die meist an den Pharynxwänden und in den Sinus piriformes lokalisiert sind (
Abb. 6.25), bildet gemeinsam mit dem Gaumensegel den velopharyngealen Abschluss. Der untere Konstriktor bildet gemeinsam mit dem M. cricopharyngeus den oberen Ösophagussphinkter, der daher auch »pharyngo-ösophageales Segment« genannt wird und hebt dabei auf die anatomisch-funktionelle Einheit dieser Muskeln ab 2 . Die kontinuierliche Kontraktion dieser Muskeln, die am Bolusende beginnt, übt einen weiteren Schub auf den Bolus aus. Ist diese Kontraktion, beispielsweise aufgrund einer neurogen bedingten pharyngealen Schwäche, beeinträchtigt, kommt es zu einer unvollständigen Bolusaustreibung und damit ebenfalls zu Residuen, die meist an den Pharynxwänden und in den Sinus piriformes lokalisiert sind (  Abb. 6.15 und
Abb. 6.15 und  Abb. 6.16).
Abb. 6.16).

Abb. 2.6: Pharyngeale Kontraktion und Austreibung des Bolus in Richtung des oberen Ösophagussphinkters. Die Luftwege sind jetzt vollständig verschlossen. Es ist kein Luftraum zwischen Arynknorpel und Epiglottis mehr erkennbar. Deutliches Verengen des Pharynx von kranial (Pfeil).
2.9 Hyolaryngeale Exkursion
Die Larynxelevation ist eine der evidentesten Aspekte des Schluckaktes, da sie den Verschluss des Atemwegs mit hervorruft und die Öffnung des oberen Ösophagussphinkters in der pharyngealen Phase unterstützt. Bei Schluckversuchen wird sie in der klinischen Diagnostik mittels Palpation regelhaft kontrolliert (  Abb. 5.2). Allerdings greift der Terminus »Elevation« in Bezug auf die Bewegungsrichtung des Larynx zu kurz, da es sich hierbei nicht nur um eine Hebung nach superior, sondern um eine nach oben und vorne gerichtete Bewegung handelt. Das Os hyoideum spielt hierbei eine ganz wesentliche Rolle, da es den Larynx mit der oberen Zungenbeinmuskulatur (sog. »suprahyoidale Muskulatur«) verbindet. Durch ihre Kontraktion hebt sich das Os hyoideum und der Larynx nach oben und vorne. Daher wird diese Bewegung auch als »ventro-kraniale Verlagerung des hyolaryngealen Komplexes« bezeichnet und unterstützt dabei biomechanisch die Öffnung des oberen Ösophagussphinkters. Folglich resultiert aus einer gestörten hyolaryngealen Exkursion sekundär auch eine insuffiziente Öffnung des Sphinkters, die pharyngeale Residuen meist in den Valleculae, den Sinus piriformes und auf der Postcricoidregion zur Folge hat. Die meisten Öffnungsstörungen des oberen Ösophagussphinkters sind auf eine reduzierte hyolaryngeale Exkursion zurückzuführen, wohingegen primäre Relaxationsstörungen nach Logemann (1988) eher selten sind und nur in etwa 6 % der Fälle beobachtet werden.
Abb. 5.2). Allerdings greift der Terminus »Elevation« in Bezug auf die Bewegungsrichtung des Larynx zu kurz, da es sich hierbei nicht nur um eine Hebung nach superior, sondern um eine nach oben und vorne gerichtete Bewegung handelt. Das Os hyoideum spielt hierbei eine ganz wesentliche Rolle, da es den Larynx mit der oberen Zungenbeinmuskulatur (sog. »suprahyoidale Muskulatur«) verbindet. Durch ihre Kontraktion hebt sich das Os hyoideum und der Larynx nach oben und vorne. Daher wird diese Bewegung auch als »ventro-kraniale Verlagerung des hyolaryngealen Komplexes« bezeichnet und unterstützt dabei biomechanisch die Öffnung des oberen Ösophagussphinkters. Folglich resultiert aus einer gestörten hyolaryngealen Exkursion sekundär auch eine insuffiziente Öffnung des Sphinkters, die pharyngeale Residuen meist in den Valleculae, den Sinus piriformes und auf der Postcricoidregion zur Folge hat. Die meisten Öffnungsstörungen des oberen Ösophagussphinkters sind auf eine reduzierte hyolaryngeale Exkursion zurückzuführen, wohingegen primäre Relaxationsstörungen nach Logemann (1988) eher selten sind und nur in etwa 6 % der Fälle beobachtet werden.

Abb. 2.7: Endpunkt der hyolaryngealen Exkursion (Pfeil oben) und Beginn des ösophagealen Bolustransports (Pfeil unten).
2.10 Öffnung und Verschluss des oberen Ösophagussphinkters (oÖS)
Der obere Ösophagussphinkter ist eine C-förmige Muskelschlinge, deren Hauptanteil vor allem aus tonischen Muskelfasern besteht und aus dem kaudalen Anteil des M. constrictor pharyngis inferior, einem Teil der kranialen Ösophagusmuskulatur sowie dem M. cricopharyngeus gebildet wird (Kahrilas 1988). Letzterer inseriert am Ringknorpel des Larynx und steht mit diesem in Bezug auf das Schlucken in einer funktionalen Verbindung.
Der obere Ösophagussphinkter ist bei einem asymmetrisch verteilten Ruhetonus kontrahiert und verhindert den Lufteintritt in die Speiseröhre beim Atmen und Sprechen sowie das Entweichen von gastrointestinalen Sekreten in den Pharynx und Larynx. Die Messung dieses Ruhedruckes ist Gegenstand der Manometrie (  Kap. 5.3.5und
Kap. 5.3.5und  Kap. 5.4.3). Die Öffnung des oberen Ösophagussphinkters wird hervorgerufen durch den Vorschub des Bolus und beginnt mit einer nerval vermittelten muskulären Relaxation, die bereits etwa 0,1 sec. vor Beginn der hyolaryngealen Exkursion einsetzt und etwa für 0,5–1,5 sec. anhält. Öffnungsweite und -dauer hängen dabei von der Bolusgröße, -konsistenz, dem Bolusdruck sowie vor allem der ventro-kranialen Verlagerung des hyolaryngealen Komplexes ab. Diese Öffnungsdynamik sorgt darüber hinaus für die Bildung eines Unterdrucks an der Spitze des Bolus, der hierdurch von unten angesaugt wird. Die Kombination aus pharyngealem Druckaufbau und der Sogwirkung durch den geöffneten Ösophaguseingang wird auch als »pharyngo-ösophagealer Saugpumpenstoß« bezeichnet.
Kap. 5.4.3). Die Öffnung des oberen Ösophagussphinkters wird hervorgerufen durch den Vorschub des Bolus und beginnt mit einer nerval vermittelten muskulären Relaxation, die bereits etwa 0,1 sec. vor Beginn der hyolaryngealen Exkursion einsetzt und etwa für 0,5–1,5 sec. anhält. Öffnungsweite und -dauer hängen dabei von der Bolusgröße, -konsistenz, dem Bolusdruck sowie vor allem der ventro-kranialen Verlagerung des hyolaryngealen Komplexes ab. Diese Öffnungsdynamik sorgt darüber hinaus für die Bildung eines Unterdrucks an der Spitze des Bolus, der hierdurch von unten angesaugt wird. Die Kombination aus pharyngealem Druckaufbau und der Sogwirkung durch den geöffneten Ösophaguseingang wird auch als »pharyngo-ösophagealer Saugpumpenstoß« bezeichnet.
Nachdem der Bolus den oberen Ösophagussphinkter passiert hat, das Os hyoideum in die Ruheposition zurückgekehrt und der Larynx sich wieder geöffnet hat, ist auch der Sphinkter wieder vollständig geschlossen und zu seinem Dauertonus zurückgekehrt (sog. »Restitutionsphase«). Der entstehende initiale Verschlussdruck ist dabei kurzfristig höher als der Ruhedruck. Dies ruft eine primäre peristaltische Welle hervor, die sich als Postrelaxationskontraktion auf den tubulären Ösophagus fortsetzt und den Bolus vorantreibt. (Lang 2013). Eine Öffnungsstörung des oberen Ösophagussphinkters führt somit zu einer Verminderung des Abschluckvolumens mit entsprechender Bildung pharyngealer Residuen, die nachfolgend auch aspiriert werden können (sog. »postdeglutitive Aspiration«). Differenzialdiagnostisch sollte dabei allerdings geklärt werden, ob es sich um eine primäre Relaxationsstörung des oÖS handelt oder die Öffnungsstörung durch eine reduzierte hyolaryngeale Exkursion hervorgerufen wird. Hierfür ist eine weitere manometrische bzw. videofluoroskopische Evaluation angezeigt.
2.11 Ösophagealer Bolustransport
Der menschliche Ösophagus ist ein mit Schleimhaut ausgekleideter Muskelschlauch und verbindet mit dem oberen Ösophagussphinkter in Höhe des 5.–6. Halswirbels und dem unteren Ösophagusphinkter, in Höhe des 11. Brustwirbels den Pharynx mit dem Magen. Sein maximaler Durchmesser hängt dabei vom jeweiligen Kontrakturzustand ab und beträgt ca. 1,5–3,5 cm (Lierse 1990). Er wird entsprechend seiner Lage in drei unterschiedlich lange Abschnitte unterteilt:
• Die pars cervicalis (ca. 8 cm),
• die Pars thoracica (ca. 16 cm)
• die Pars abdominalis (ca. 1–3 cm).
Der tubuläre Ösophagus beginnt an der unteren Grenze des oberen Ösophagussphinkters am 6. Halswirbel (Mashimo und Goyal 2006). Der proximale Anteil des Ösophagus besteht aus quergestreifter Skelettmuskulatur, auf Höhe des Aortenbogens folgt die ca. 4–6 cm lange sog. »Transitionszone«, die den Übergang von quergestreifter zu glatter Muskulatur bezeichnet, bis hin zum distalen Bereich, der ausschließlich aus glatter Muskulatur besteht. Innerhalb der Transitionszone wird die schwächste Kraft der peristaltischen Kontraktion gemessen.
Читать дальше
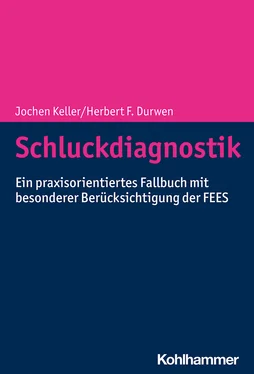
 Abb. 6.25), bildet gemeinsam mit dem Gaumensegel den velopharyngealen Abschluss. Der untere Konstriktor bildet gemeinsam mit dem M. cricopharyngeus den oberen Ösophagussphinkter, der daher auch »pharyngo-ösophageales Segment« genannt wird und hebt dabei auf die anatomisch-funktionelle Einheit dieser Muskeln ab 2 . Die kontinuierliche Kontraktion dieser Muskeln, die am Bolusende beginnt, übt einen weiteren Schub auf den Bolus aus. Ist diese Kontraktion, beispielsweise aufgrund einer neurogen bedingten pharyngealen Schwäche, beeinträchtigt, kommt es zu einer unvollständigen Bolusaustreibung und damit ebenfalls zu Residuen, die meist an den Pharynxwänden und in den Sinus piriformes lokalisiert sind (
Abb. 6.25), bildet gemeinsam mit dem Gaumensegel den velopharyngealen Abschluss. Der untere Konstriktor bildet gemeinsam mit dem M. cricopharyngeus den oberen Ösophagussphinkter, der daher auch »pharyngo-ösophageales Segment« genannt wird und hebt dabei auf die anatomisch-funktionelle Einheit dieser Muskeln ab 2 . Die kontinuierliche Kontraktion dieser Muskeln, die am Bolusende beginnt, übt einen weiteren Schub auf den Bolus aus. Ist diese Kontraktion, beispielsweise aufgrund einer neurogen bedingten pharyngealen Schwäche, beeinträchtigt, kommt es zu einer unvollständigen Bolusaustreibung und damit ebenfalls zu Residuen, die meist an den Pharynxwänden und in den Sinus piriformes lokalisiert sind (