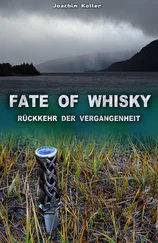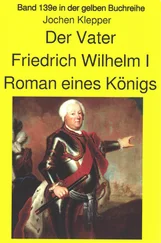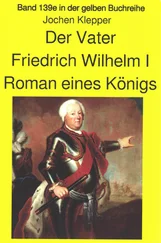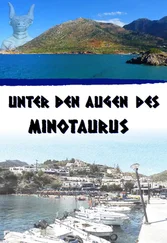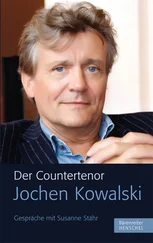Dies macht deutlich, dass es sich bei Schluckstörungen, wie es der Terminus suggerieren mag, nicht ausschließlich um eine Funktionseinschränkung im engeren Sinne handelt, sondern vielmehr alle drei Ebenen der ICF (engl.: »International Classification of Functioning, Disability and Health«), wie Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten sowie die gesellschaftliche Teilhabe, betroffen sein können (Prosiegel 2005a).
Vor diesem Hintergrund muss die Behandlung von Schluckstörungen multiprofessionell ausgerichtet sein und setzt eine akkurate und interdisziplinäre Diagnostik voraus, die eine detaillierte Evaluation der individuellen Symptomatik sowie deren Pathogenese zum Ziel hat. Dieser diagnostische Prozess, der sich je nach Ätiologie in unterschiedlichen Verfahren abbildet, involviert verschiedene Berufsgruppen, wie Gastroenterologen, Geriater, HNO-Ärzte, Neurologen, Radiologen und Sprachtherapeuten und soll Gegenstand der weiteren Ausführungen sein.
1 Kasuistiken in der klinischen Dysphagiologie
Die Betrachtung des Einzelfalls ist seit jeher ein wertvoller Bestandteil wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Die systematische Darstellung von Kasuistiken hat vor allem in den Sozialwissenschaften, der Pädagogik und Psychologie eine lange Tradition. Im medizinischen Bereich ist sie infolge der Fokussierung auf eine statistisch dominierte, evidenzbasierte Forschung etwas in den Hintergrund getreten, bleibt jedoch ein unverzichtbarer Bestandteil der ärztlichen Ausbildung. Insbesondere bei der Beobachtung seltener oder noch unbekannter Phänomene und Zusammenhänge, steht die Betrachtung des konkreten Einzelfalls häufig am Anfang weiterer wissenschaftlicher Analysen, kann aber gleichzeitig auch eine lehrreiche Illustration bereits bestehender Erkenntnisse sein. Eine Kasuistik sollte sich daher nicht nur in einer detaillierten Beschreibung des Einzelfalls erschöpfen, sondern – soweit vorhanden – auch stets Bezug auf bereits bestehende Forschungsergebnisse nehmen. Dieser Anspruch wird in Bezug auf Schluckstörungen bereits im Titel einer sehr empfehlenswerten Veröffentlichung von Coyle et al. (2007) mit dem Titel »Evidence-Based to Reality-Based Dysphagia Practice: Three Case Studies« deutlich. Hier werden drei Kasuistiken dysphagischer Patienten aus der klinischen Praxis dargestellt und der diagnostische Prozess vor dem Hintergrund fortlaufender Hypothesenbildungen mit Bezug auf die jeweils bestehenden evidenzbasierten wissenschaftlichen Grundlagen aufgezeigt.
Kasuistiken erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und widersprechen nicht der durchaus berechtigten Forderung einer Orientierung an evidenzbasierten Daten in der Medizin. Sie sind vielmehr ein wichtiges Instrumentarium zum Verständnis klinischer Phänomene und nehmen in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften einen hohen Stellenwert ein.
Ihre didaktischen Vorzüge liegen vor allem in einer systematischen Darstellung der individuellen Krankengeschichte, des diagnostischen Prozedere, der beobachteten Symptomatik sowie ggf. auch darauf aufbauender therapeutischer Interventionen.
Blickt man beispielsweise in die Historie der Neurowissenschaften, so war die genaue Beschreibung der Symptomatik hirnverletzter Patienten nicht nur für das Verständnis von Störungen höherer kortikaler Funktionen von Bedeutung. Vielmehr führte sie letztlich auch zu einem tieferen Verständnis dieser Hirnfunktionen selbst und ebnete den Weg zur Entwicklung erster therapeutischer Verfahren (Leischner 1987). Zu erinnern sei z. B. an den im Jahre 1868 berichteten Fall des Arbeiters Phineas Gage, dem während einer Explosion eine Eisenstange durch den Frontallappen seines Gehirns getrieben wurde und dessen Sozialverhalten und Charakter sich daraufhin erheblich veränderten (Damasio 2010). Auch die erste systematische Beschreibung einer nicht-flüssigen Aphasie durch den französischen Chirurgen und Anthropologen Paul Broca sowie der von Carl Wernicke beschriebene Verlust der Fähigkeit, Sprache zu verstehen, bildeten später die Grundlage der heute noch gültigen Syndromeinteilung von Aphasien (Hartje und Poeck 2006). Andererseits reihten sich derartige Einzelfalldarstellungen in die damals aktuellen Diskussionen bezüglich der Art und Lokalisierbarkeit höherer kortikaler Funktionen ein, die in der sog. »Phrenologie« ihren Ursprung nahmen.
In Zeiten moderner Bildgebung weiß man heute, dass derartige komplexe Hirnfunktionen, wie beispielsweise die Sprachfähigkeit eines Menschen, von einem neuronalen Netzwerk hervorgebracht werden, prozesshaft ablaufen und durch entsprechende Konnektionsbahnen miteinander verbunden sind.
Auch in Bezug auf die nervale Steuerung des Schluckaktes sprechen wir heute von einem »Schlucknetzwerk«, das mehrere neuronale Zentren involviert (Hamdy et al. 1996; Jean 2001; Warnecke und Dziewas 2018). Insbesondere in der Betrachtung neurogener Dysphagien ist das Konzept eines netzwerkgesteuerten Schluckaktes sowohl für die Diagnostik als auch die Therapie von entscheidender Bedeutung. So beschrieb James Parkinson in seiner historischen Schrift »An essay on the shaking palsy« aus dem Jahre 1817, einen Patienten, der neben den typischen parkinsonassoziierten Bewegungsstörungen, offensichtlich auch die Fähigkeit zur selbständigen Nahrungsaufnahme verloren hatte und dem es schwerfiel, die Nahrung im Mund zu behalten und zu schlucken (Parkinson 1817). Die Beobachtung, dass Parkinsonpatienten nicht nur extrapyramidal-motorische, sondern auch sensible Störungen aufweisen, bestätigten die Forschungsergebnisse von Braak et al. (2004), die stadienabhängige degenerative Veränderungen auf mehreren Etagen des zentralen Nervensystems, vor allem auch des Hirnstamms, bei der Parkinson-Erkrankung nachweisen konnten (  Kap. 6.2.1).
Kap. 6.2.1).
Die Tatsache, dass einige der Betroffenen auch Dysphagien aufwiesen, führte allerdings schon sehr viel früher zur Entwicklung eines ersten Untersuchungsprotokolls der radiografischen Untersuchung oropharyngealer Dysphagien, damals noch »cookie swallow test« genannt (Logemann et al. 1983). Dieser wurde von der Sprachtherapeutin und Autorin, Jeri A. Logemann, erstmals beim Kongress der »American Speech and Hearing Association« (ASHA) im Jahre 1976 in Houston vorgestellt.
Abgesehen von dem außerordentlich komplexen Gebiet der oropharyngealen Dysphagien, lässt sich die Entwicklung von der Kasuistik, hin zur differenzierten Erkenntnis der beschriebenen Störungsphänomene, auch im Bereich ösophagealer Dysphagien nachvollziehen. So wurde beispielsweise schon im Jahre 1675 von Thomas Willis ersmalig ein Patient beschrieben, dessen Schluckstörung erfolgreich durch die Dehnung des Mageneingangs mittels eines Walfischknochens behandelt werden konnte. Die hier zugrunde liegende Erkrankung wurde genau 240 Jahre später durch Hertz (1914) mit einer fehlenden Öffnung des unteren Ösophagussphinkters in Verbindung gebracht und ist heute unter dem Begriff der »Achalasie« bekannt. Nachfolgend konnten degenerative Veränderungen des dorsalen Vaguskerns sowie intrazelluläre Einschlusskörperchen (sog. »Lewy bodies«) in den Ganglienzellen des Plexus myentericus als pathogenetisches Korrelat nachgewiesen werden (Cassella et al. 1964). Das Behandlungsprinzip der Überdehnung des hypertonen Sphinkters (»Bougierung«) wird heute in Form der sog. »Ballondehnung« bzw. »pneumatischen Dilatation« eingesetzt (Fellows et al. 1983).
Dies macht deutlich, dass allein schon die theoretische Aufbereitung von Kasuistiken zu einer ersten Strukturierung und Ordnung beobachteter klinischer Phänomene führt. Gerade die interdisziplinäre Diskussion, im Spannungsfeld unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen und Theoriebildungen, kann letztlich zu einem tieferen Verständnis und zu weiteren Forschungsansätzen führen. So bilden Kasuistiken auch in speziellen Fortbildungs- und Kursprogrammen zum Thema »Dysphagie«, wie z. B. den FEES-Basiskursen oder -Expertenworkshops, ein unverzichtbares Element (Dziewas et al. 2018). Letztlich ist der »besondere Einzelfall« sinnvollerweise immer auch Thema in Fachjournalen und auf medizinischen Kongressen (Babores und Finnerty 1998; Barikroo und Lam 2011; Keller und Durwen 2020 und 2017b).
Читать дальше
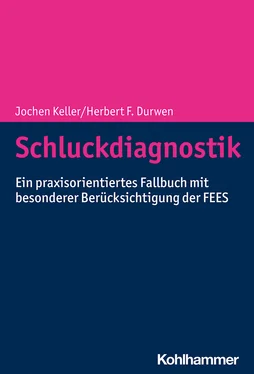
 Kap. 6.2.1).
Kap. 6.2.1).