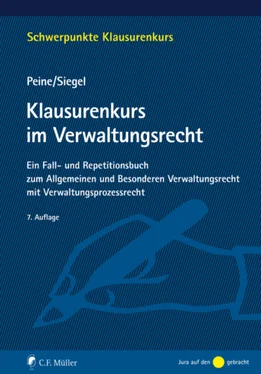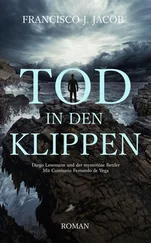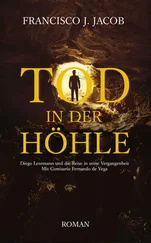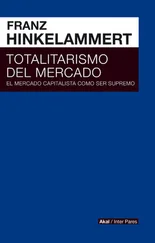[1]
So auch Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 19 Rn. 5 ff.
b) Die beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzungen
158
Die beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzungen richten sich grundsätzlich nach allgemeinen Grundsätzen (s.o. Rn. 66 ff.). Allerdings bestehen einige Besonderheiten. Dies gilt zunächst für die passive Prozessführungsbefugnis. Denn der Antrag ist nach § 47 Abs. 2 S. 2 VwGO (stets) zu richten gegen die Körperschaft, Anstalt oder Stiftung, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat. Damit hat der Bundesgesetzgeber das Rechtsträgerprinzip manifestiert. Dies gilt auch für diejenigen Bundesländer, welche im Übrigen auf Grundlage des § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO das Rechtsträgerprinzip durch das Behördenprinzip ersetzt haben (s.o. Rn. 67).
159
Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber in § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO eine etwas versteckte Regelung zur aktiven Beteiligtenfähigkeit von Behördengetroffen. Danach kann den Antrag (auch) jede Behörde stellen. Dies impliziert deren Beteiligtenfähigkeit. Schließlich kommt wegen der erstinstanziellen Zuständigkeit des OVG/VGH die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 4 VwGOzur Anwendung. Danach müssen sich die Beteiligten grundsätzlich durch einen Prozessbevollmächtigten i.S.d. § 67 Abs. 2 VwGO vertreten lassen.
c) Die Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO
160
Stellt den Antrag eine natürliche oder juristische Person, muss sie ihre Antragsbefugnis belegen. Sie muss folglich geltend machen, dass die angegriffene Rechtsvorschrift oder deren Anwendung sie in ihren eigenen Rechten verletzt oder verletzen wird. Die Parallele zur Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO liegt auf der Hand. Entsprechend ist es ausreichend, dass die Rechtsverletzung nach dem Sachvortrag als möglich erscheint. Besonders klausurrelevant sind Normenkontrollanträge gegen Bebauungspläne. Hier hat das BVerwG ein (allerdings) begrenztes Recht auf gerechte Abwägunganerkannt[1]. Danach beinhaltet das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB auch das subjektive öffentliche Recht, dass eigene abwägungserhebliche Belange berücksichtigt und ihrem Gewicht entsprechend abgearbeitet werden[2]. Es verleiht damit kein „Durchsetzungsrecht“, sondern lediglich (aber immerhin) ein „Abarbeitungsrecht“. Voraussetzung ist jedoch die Abwägungserheblichkeit des Belangs[3].
161
Antragsbefugt sind darüber hinaus nach § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO auch Behörden. Anders als natürliche oder juristische Personen müssen sie aber nicht geltend machen, in ihren Rechten verletzt zu sein. Dies könnten sie auch gar nicht; denn sie verfügen über keine (subjektiven) Rechte, sondern über (objektive) Kompetenzen. Allerdings wird der weit gefasste Wortlaut einschränkend ausgelegt. Behörden müssen ein objektives Kontrollinteresse nachweisen und daher mit der Anwendung der Norm befasst sein[4]. Darüber hinaus eröffnet § 7 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwRG auch anerkannten Umweltvereinigungenin gewissem Umfange die Möglichkeit einer prinzipalen Normenkontrolle[5].
[1]
BVerwGE 107, 215 (220 ff.).
[2]
Ziekow , in: Sodan/Ziekow, GK ÖR, 9. Aufl. 2020, § 71 Rn. 6.
[3]
BVerwG, NVwZ 2015, 1457 f.
[4]
VGH Mannheim, NVwZ-RR 2006, 232; Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 970.
[5]
Zur genauen Reichweite Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 4 Rn. 122.
162
Die Antragsfrist beträgt ein Jahr nach Bekanntmachungder angegriffenen Vorschrift in dem für sie vorgesehenen Verkündigungsblatt. Zuvor enthielt § 47 Abs. 2a VwGO aF zudem eine Präklusionsregelung. Diese ist vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH[1] jedoch mit Wirkung vom 2. Juni 2017 aufgehoben worden[2]. Unverändert Bestand hat hingegen die im materiellen Recht verankerte Präklusionsregelung des § 4a Abs. 6 BauGB, die jedoch eine beschränkte Reichweite aufweist[3].
[1]
EuGH, NVwZ 2015, 1665 ff.
[2]
Hierzu Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 4 Rn. 115.
[3]
Hierzu Finkelnburg/Ortloff/Kment , ÖffBauR, Bd. I; 7. Aufl. 2017, § 6 Rn. 63 f.
III. Erläuterungen zum Aufbauschema – Begründetheitsfragen
163
Der Obersatz zur Begründetheitsprüfung ergibt sich aus § 47 Abs. 5 S. 2 VwGO. Der Normenkontrollantrag ist begründet, wenn bzw. soweit die beanstandete Norm „ungültig“ist. Auch hier empfiehlt es sich oftmals, die Konjunktion „wenn“ durch ein „soweit“ zu ergänzen. Denn Satzungen und Rechtsverordnungen können auch nur teilweise ungültig sein. Nicht zu prüfen ist hingegen im Unterschied zur Anfechtungsklage (s.o. Rn. 99), ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist. Darin kommt das Wesen des § 47 VwGO als objektives Beanstandungsverfahrenzum Ausdruck[1]. Allerdings ist dieser Begriff nicht vollständig zutreffend. Denn im Rahmen der Zulässigkeit ist bei natürlichen und juristischen Personen sehr wohl zu prüfen, ob sie möglicherweise in ihren Rechten verletzt sind (s.o. Rn. 160). Damit wird eine „Popularnormenkontrolle“ ausgeschlossen. In der Praxis ist wegen der beschränkten Begründetheitsprüfung teilweise die latente Tendenz zu beobachten, im Rahmen der Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 VwGO etwas strengere Maßstäbe anzulegen als bei der Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO.
[1]
Erbguth/Guckelberger , AllgVerwR, 10. Aufl. 2020, § 28 Rn. 2.
2. Gültigkeit der Rechtsverordnung/Satzung
a) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
164
Im Rahmen der Begründetheit ist zunächst zu prüfen, ob die Rechtsverordnung/Satzung mit höherrangigem Recht in Einklangsteht. Zu den zu beachtenden Vorgaben zählen solche der einfachen Gesetze, aber auch verfassungsrechtliche[1]. Hier ist nach allgemeinen Grundsätzen zu unterscheiden zwischen formellen und materiellen Anforderungen. – Bei den besonders häufig vorkommenden Normenkontrollanträgen gegen Bebauungsplänerichten sich die formellen Anforderungen im Ausgangspunkt nach §§ 2 ff. BauGB[2]. Da Bebauungspläne gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in den Flächenstaaten[3] durch die Gemeinden erlassen werden, kommen ergänzend Anforderungen nach dem Kommunalrecht hinzu[4]. Die materiellen Anforderungen richten sich ebenfalls grundsätzlich nach dem BauGB[5].
[1]
Am Beispiel von kommunalrechtlichen Satzungen Burgi , Kommunalrecht, 6. Aufl. 2019, § 15 Rn. 21 ff.
[2]
Hierzu Schubert , in: Erbguth/Mann/Schubert, BesVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 894 ff.
[3]
Ebenso in Bremen mit den Gemeinden Bremen und Bremerhaven.
[4]
Hierzu Mann , in: Erbguth/Mann/Schubert, BesVerwR, 13. Aufl. 2020 Rn. 221 ff.
[5]
Hierzu Schubert , in: Erbguth/Mann/Schubert, BesVerwR, 13. Aufl. 2020 Rn. 951 ff.
b) Beachtlichkeit festgestellter Verstöße
165
Werden Verstöße gegen höherrangiges Recht festgestellt, so ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob dieser Verstoß auch beachtlich ist. Steht eine Rechtsvorschrift hingegen in Einklang mit höherrangigem Recht, so erübrigt sich dieser Schritt. Der zweite Prüfschritt nach festgestellter Rechtswidrigkeit ist deswegen von Bedeutung, weil der Gesetzgeber in einigen examensrelevanten Bereichen Fehler teilweise für unbeachtlich erklärt hat. Dies gilt insbesondere für Fehler bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Hier hat der Gesetzgeber in §§ 214 f. BauGBden Grundsatz der Planerhaltung aufgegriffen. Einige – eher geringfügige – Verstöße sind unbeachtlich, andere können durch Fristablauf geheilt werden, weitere in einem ergänzenden Verfahren[1]. Darüber hinaus enthalten auch die kommunalrechtlichen LandesgesetzeBestimmungen zur Unbeachtlichkeit bestimmter Fehler[2]. Die auf den ersten Blick komplizierte Abgrenzung beider Fehlerfolgenregime beim Erlass von Bebauungsplänen richtet sich schlicht danach, ob ein Verstoß gegen Bestimmungen des BauGB vorlag – dann richtet sich die Beachtlichkeit nach §§ 214 f. BauGB – oder gegen Bestimmungen des Kommunalrechts – dann sind auch die kommunalrechtlichen Unbeachtlichkeitsbestimmungen maßgeblich. Denn ein Gesetzgeber kann aus Kompetenzgründen nicht die Anforderungen des anderen Gesetzgebers für unbeachtlich erklären[3].
Читать дальше