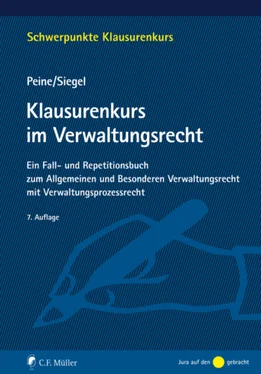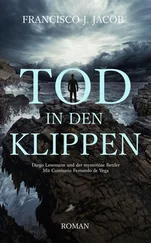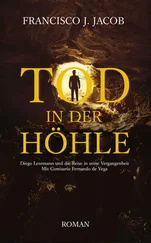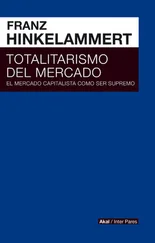[1]
Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 17 Rn. 11.
[2]
Detterbeck , AllgVerwR, 18. Aufl. 2020, Rn. 1393.
III. Erläuterungen zum Aufbauschema – Begründetheitsfragen
150
Die allgemeine Klage ist begründet, wenn bzw. soweit der Kläger einen Anspruch auf die begehrte Leistunghat. Sofern auch hier ein Teilerfolg möglich ist, empfiehlt es sich auch bei der allgemeinen Leistungsklage, zumindest ergänzend ein „soweit“ anzuführen.
151
Entsprechend der Unterteilung der Leistung in positives Tun, Dulden und Unterlassen fällt die Begründetheitsprüfung bei der allgemeinen Leistungsklage differenziert aus. Es muss zunächst die bereits im Rahmen der Klagebefugnis relevante Anspruchsgrundlagefür das Begehren benannt werden. Sie kann aus dem Gesetz, einem anerkannten öffentlich-rechtlichen Rechtsinstitut, einem öffentlich-rechtlichen Vertrag oder einer Zusicherung hergeleitet werden. Besonders klausurrelevantsind Folgenbeseitigungsansprüche und gesetzliche Unterlassungsansprüche sowie allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche[1]. Aber auch Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Verträgenkönnen, sofern keine sofortige Vollstreckung gemäß § 61 VwVfG möglich ist, im Wege der allgemeinen Leistungsklage durchgesetzt werden. Dann muss sich der Anspruchsinhalt aus dem Vertrag ergeben, und dieser muss wirksam (!) sein[2].
[1]
Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 908, 911, 927.
[2]
Hierzu Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 785 ff.
2. Teil Repetitorium im Verwaltungsprozessrecht› 3. Kapitel Rechtsbehelfe in der Hauptsache› F. Die Normenkontrolle nach § 47 VwGO
F. Die Normenkontrolle nach § 47 VwGO
152
Teil 1: Sachentscheidungsvoraussetzungen einer Normenkontrolle
| 1. |
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs/Zuständigkeit – § 40 Abs. 1 S. 1/§ 47 Abs. 1 VwGO |
| 2. |
Die Statthaftigkeit des Normenkontrollantrags – § 47 Abs. 1 VwGO |
| 3. |
Verfahrensartabhängige Sachentscheidungsvoraussetzungen a) Beteiligtenbezogene Sachentscheidungsvoraussetzungen b) Antragsbefugnis – § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO c) Frist – § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO |
| 4. |
Ordnungsgemäße Antragstellung – §§ 81 f. VwGO analog |
| 5. |
Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis |
Teil 2: Begründetheit einer Normenkontrolle
| 1. |
Obersatz |
| 2. |
Passivlegitimation |
| 3. |
Gültigkeit der Rechtsverordnung/Satzung a) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht b) (bei festgestelltem Verstoß) Beachtlichkeit des Verstoßes? |
II. Erläuterungen zum Aufbauschema – Sachentscheidungsvoraussetzungen
1. Statthaftigkeit eines Normenkontrollantrags
153
Das mit dem Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO verfolgte Begehren ist darauf gerichtet, dass das Oberverwaltungsgericht über die Gültigkeit bestimmter untergesetzlicher Rechtsnormen befindet. Da die Gültigkeit einer Norm in Frage steht, wird das Verfahren nach § 47 VwGO auch als prinzipale Normenkontrollebezeichnet. Davon zu unterscheiden ist zunächst die inzidente Normenkontrolle. Sie richtet sich gegen einen auf die Norm gestützten Vollzugsakt, insbesondere einen Verwaltungsakt. Bei dessen Überprüfung wird sodann inzident untersucht, ob die betreffende Norm eine tragfähige Grundlage für diesen Vollzugsakt bildet. Schließlich kann nach Maßgabe des § 43 VwGO auch eine Feststellungsklage als „heimliche Normenkontrolle“ erhoben werden (s.o. Rn. 116)[1].
154
Die genaue Reichweite der prinzipalen Normenkontrolle richtet sich nach § 47 Abs. 1 VwGO. Dabei kommen von vornherein nur Rechtsverordnungen und Satzungen und damit Gesetze im lediglich materiellen Sinne in Betracht[2]. Gegen formelle Gesetze ist hingegen Rechtsschutz vor den Verfassungsgerichten zu suchen. Kraft Bundesrechts ist die Normenkontrolle nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGOstatthaft gegen Satzungen nach dem BauGB und diesen gleichgestellte Rechtsverordnungen. Damit wird zugleich der wichtigste und zugleich klausurträchtigste Anwendungsfall der Normenkontrolle umschrieben. Denn insbesondere Bebauungspläne werden gemäß § 10 Abs. 1 BauGB grundsätzlich als Satzungen erlassen. Den Satzungen aufgrund des BauGB ausdrücklich gleichgestellt werden Rechtsverordnungen, die aufgrund des § 246 Abs. 2 BauGB erlassen werden. Damit wird den Besonderheiten der Stadtstaaten Rechnung getragen, welche – abgesehen von Bremen, das sich aus den Gemeinden Bremen und Bremerhaven zusammensetzt – keine Gemeinden besitzen und in denen daher folgerichtig auch keine Satzungen erlassen werden können. So werden etwa in Berlin die Bebauungspläne in Form einer Rechtsverordnung erlassen[3].
155
Flächennutzungspläneentfalten als Innenrechtsätze sui generis grundsätzlich keine Außenwirkung und sind deshalb regelmäßig nicht der Normenkontrolle nach § 47 VwGO zugänglich[4]. Anders verhält es sich indessen, wenn sie für privilegierte Vorhaben im Außenbereich sog. Vorrang- oder Konzentrationsflächenausweisen, insbesondere für Windenergieanlagen. Insoweit besitzen sie wegen des bebauungsplanähnlichen Charakters Außenwirkung und sind folgerichtig einer Normenkontrolle zugänglich. § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist insoweit analog anzuwenden[5]. Die Statthaftigkeit ist aber in solchen Fällen beschränkt auf sog. Negativ- oder Tabuflächen, in denen wegen der anderweitigen Vorrangflächen gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauBG eine Ausschlusswirkung eintritt[6].
156
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGOgestattet es dem Landesgesetzgeber, auch sonstige Vorschriften unter dem Landesgesetzdurch das Oberverwaltungsgericht überprüfen zu lassen. Von der Möglichkeit nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO haben insgesamt 13 Bundesländer in ihren jeweiligen Ausführungsgesetzen zur Verwaltungsgerichtsordnung Gebrauch gemacht[7]. In den anderen drei Bundesländern, also Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen, verbleibt es hingegen bei den eingangs dargelegten sonstigen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Rechtsverordnungen und Satzungen (s.o. Rn. 153).
[1]
Zum Rechtsschutz gegen Normen außerhalb des § 47 VwGO Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 1142 ff.
[2]
Begriff und Abgrenzung zu Gesetzen im formellen Sinne bei Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 68 ff.
[3]
Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 4 Rn. 31.
[4]
BVerwG, NVwZ 1991, 262 f.
[5]
BVerwG, NVwZ 2007, 1081 f.
[6]
BVerwG, NVwZ 2015, 1452 (1453); NVwZ 2019, 491 (493).
[7]
Übersicht bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 19 Rn. 16.
2. Besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen
157
Besonderheiten ergeben sich bereits bei der Benennung des zuständigen Gerichts. Denn § 47 Abs. 1 VwGO begründet eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts/Verwaltungsgerichtshofs. Dabei handelt es sich um eine wichtige und zugleich klausurträchtige Ausnahme vom Grundsatz des § 45 VwGO (s.o. Rn. 65). Da jedes Bundesland über ein Oberverwaltungsgericht bzw. einen Verwaltungsgerichtshof verfügt, erübrigen sich zugleich Ausführungen zur örtlichen Zuständigkeit. Zwar ist die instanzielle Zuständigkeit des OVG/VGH eine Folge der Statthaftigkeit. Aus klausurökonomischen Gründen empfiehlt es sich jedoch, die Zuständigkeit sogleich zu Beginn gemeinsam mit der Frage der Rechtswegeröffnung zu erörtern[1]. Denn beide Prüfungspunkte werfen nur selten Probleme auf. Dies gilt insbesondere für den Klausurklassiker einer Normenkontrolle gegen einen Bebauungsplan.
Читать дальше