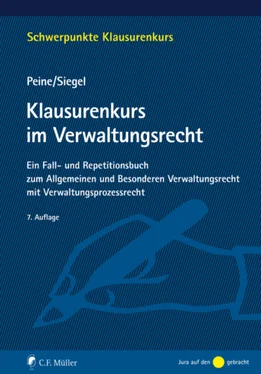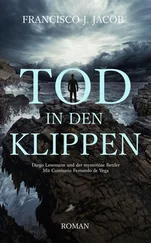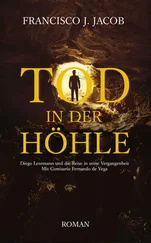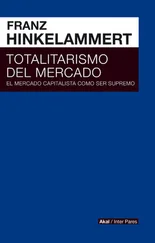132
Besonders relevant ist die Wiederholungsgefahr. Allerdings genügt hier keine abstrakte Wiederholungsgefahr, da eine solche praktisch immer vorläge und daher keine Eingrenzung bewirken würde. Erforderlich ist vielmehr eine konkreteWiederholungsgefahr. Dazu müssen (in einer Anfechtungsklagesituation) konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass in absehbarer Zeit der Erlass einer ähnlichen Entscheidung bei im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen ergehen wird[3].
133
Darüber hinaus kann ein berechtigtes Interesse auch bei der Vorbereitung eines Amtshaftungs- oder Entschädigungsprozesses liegen. Der tiefere Grund für diese oftmals auch als Präjudizbezeichnete Fallgruppe liegt in der Prozessökonomie: Die dem Verwaltungsrecht typischerweise näherstehenden Verwaltungsgerichte sollen abschließend über die Rechtswidrigkeit befinden; und die mit dem nachfolgenden Amtshaftungsprozess befassten ordentlichen Gerichte sind sodann an die Feststellungen zur Rechtswidrigkeit gebunden[4]. Der Anwendungsbereich dieser Fallgruppe ist jedoch in zweierlei Hinsicht begrenzt: Zunächst darf der Amtshaftungsprozess nicht offensichtlich aussichtslossein[5]. Damit wird jedoch – auch in der Klausur – regelmäßig keine vollständige Prüfung der Erfolgsaussichten erwartet. Vielmehr sollen diejenigen Konstellationen ausgeschlossen werden, in denen ein Anspruch unter keinem denkbaren Gesichtspunkt bestehen kann. Zudem greift das als Begründung für diese Fallgruppe eingangs herangezogene Argument der Prozessökonomie lediglich dann ein, wenn ein Prozess bereits bei den Verwaltungsgerichten anhängig ist und damit in den Fällen einer nachträglichen Erledigung. Tritt die Erledigung hingegen bereits vor Klageerhebung ein, so wird dem Kläger zugemutet, sogleich die ordentlichen Gerichte anzurufen[6].
134
Die dritte allgemein anerkannte Fallgruppe bildet das Rehabilitationsinteresse. Hiervon werden solche Situationen erfasst, die bei objektiver Betrachtung eine diskriminierende Wirkung entfalten. Eine solche Wirkung ist etwa dann anzunehmen, wenn eine Person als Störer während einer Demonstration in Anspruch genommen wird[7].
135
Darüber hinaus wird oftmals auch im Falle eines gewichtigen Grundrechtseingriffsein berechtigtes Interesse gesehen[8]. Diese Fallgruppe wird jedoch zunehmend in Zweifel gezogen[9]. Denn zunächst bildet der Grundrechtseingriff als solcher in der Eingriffsverwaltung kein taugliches Differenzierungskriterium. Das daher unerlässliche Kriterium der „Gewichtigkeit“ bedarf zudem einer einzelfallbezogenen Quantifizierung. Darüber hinaus können die in der Rechtsprechung anerkannten „gewichtigen Grundrechtseingriffe“ oftmals auch den anderen Fallgruppen zugeordnet werden, insbesondere dem Rehabilitationsinteresse.
136
Schließlich findet in jüngerer Zeit eine weitere Fallgruppe zunehmend Verbreitung: Vor dem Hintergrund des Art. 19 Abs. 4 GG wird teilweise ein berechtigtes Interesse anerkannt, wenn sich eine Maßnahme so kurzfristig erledigthat, dass ohne Annahme eines berechtigten Interesses keine gerichtliche Überprüfung möglich wäre[10]. Auch diese Fallgruppe begegnet jedoch Bedenken. Denn gerade auf dem Gebiet des Polizeirechts ist eine kurzfristige Erledigung der praktische Regelfall. Die Kurzfristigkeit bildet daher ebenfalls kein taugliches Differenzierungskriterium.
[1]
Ziekow , in: Sodan/Ziekow, GK ÖR, 9. Aufl. 2020, § 102 Rn. 6.
[2]
Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 47 („insbesondere“).
[3]
BVerwGE 146, 303 (307).
[4]
BVerwG, NVwZ 2015, 600 (602).
[5]
BVerwG, NVwZ-RR 2016, 362 (364).
[6]
BVerwGE 81, 226, 227.
[7]
Hierzu sowie zu weiteren Beispielen Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 50.
[8]
BVerwGE 61, 164 ff.
[9]
Etwa bei Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 633. Zurückhaltend auch BVerwG, NVwZ 2013, 1481, 1484.
[10]
OVG Münster, NVwZ 2018, 1497 (1498).
b) Die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen der Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage analog
137
Die Fortsetzungsfeststellungsklage setzt im Prinzip das erledigte Anfechtungs- oder Verpflichtungsbegehren fort. Deshalb müssen grundsätzlich auch die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen der erledigten Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage vorliegen. Mit anderen Worten: Ist die (hypothetische) Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage vor dem Erledigungszeitpunkt unzulässig, ist auch die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht zulässig. Für die Klausurbearbeitung ist weiter zu differenzieren zwischen einer Erledigung nach und vor Klageerhebung.
138
Tritt die Erledigung nach Klageerhebungein, so hat in der Praxis das Verwaltungsgericht bereits in einem ersten Schritt das Vorliegen der besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage bejaht. Denn anderenfalls hätte es diese als unzulässig abgewiesen. Allerdings müssen die Sachentscheidungsvoraussetzungen auch noch zum Zeitpunkt des Feststellungsantrags vorliegen. Ein nachträglicher Wegfall der Sachentscheidungsvoraussetzungen ist aber allenfalls in theoretischen Ausnahmefällen denkbar. In der Klausurbearbeitungsind die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzung hingegen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch nicht geprüft worden. Sie müssen daher gesondert festgestellt werden.
139
Teilweise anders verhält es sich, wenn die Erledigungbereits vor Klageerhebungeintritt. Auch hier folgt zwar aus dem Wesen der Fortsetzungsfeststellungsklage als „fortgesetzte“ Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage, dass ebenfalls eine Klagebefugnisnach § 42 Abs. 2 VwGO vorliegen muss. Anders verhält es sich mit dem Vorverfahren und der Klagefrist. Hier besteht regelmäßig keine Gefahr einer Relativierung der Bestandskraft oder einer Umgehung der besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen. Daher werden die Durchführung eines Vorverfahrens sowie die Einhaltung einer Klagefrist grundsätzlich für entbehrlich gehalten[1]. Allerdings darf der betreffende Verwaltungsakt nicht bereits vor seiner Erledigung bestandskräftig geworden sein; anderenfalls wäre auch eine Fortsetzungsfeststellungsklage unzulässig. Darauf, dass bei einer Erledigung vor Klageerhebung die Fallgruppe des Präjudizes nicht anerkannt wird, wurde bereits hingewiesen (s.o. Rn. 133).
[1]
Ziekow , in: Sodan/Ziekow, GK ÖR, 9. Aufl. 2020, § 102 Rn. 11 und 12.
III. Erläuterungen zum Aufbauschema – Begründetheit der Fortsetzungsfeststellungsklage
140
Der Obersatz orientiert sich grundsätzlich an demjenigen für eine Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage, muss diesen jedoch wegen der Erledigung in die Vergangenheit setzen. Die Formulierung lautet für die Fortsetzungsfeststellungsklage, die eine Anfechtungsklage fortsetzt: Die Klage des A ist begründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig war und der Kläger in seinen Rechten verletzt wurde. Für die Verpflichtungsklage ist folgender Satz geeignet: Die Klage des A ist begründet, wenn er einen Anspruch auf Erlass des verweigerten und nunmehr erledigten Verwaltungsakts hatte.
2. Das Prüfungsprogramm der Begründetheit der Ausgangsklage
141
Das Prüfungsprogramm mit Blick auf die Begründetheit der Fortsetzungsfeststellungsklage entspricht dem der Anfechtungs- oder der Verpflichtungsklage. Insoweit kann auf die Ausführungen zur Anfechtungsklage bzw. Verpflichtungsklage verwiesen werden (s.o. Rn. 94 ff.und 109 ff.).
Читать дальше