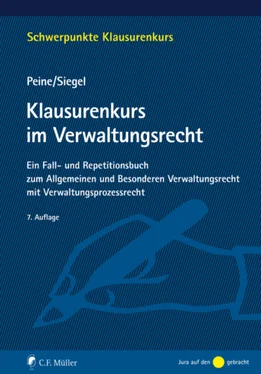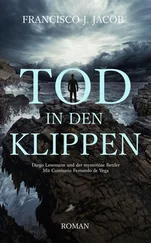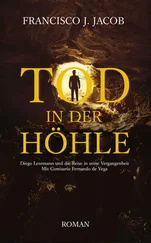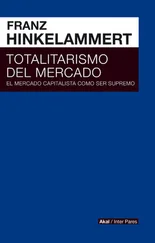[1]
Übersicht über die Anforderungen sowie die Prüfungsabfolge des § 44 VwVfG bei Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 546 ff.
2. Die Subsidiaritätsklausel
119
Eng verwoben mit der Frage der Statthaftigkeit ist die Subsidiarität der Feststellungsklage gegenüber Gestaltungs- und Leistungsklagen nach § 43 Abs. 2 S. 1 VwGO: Nach dieser Bestimmung kann der Kläger die Feststellung nicht begehren, wenn er seine Rechte durch Erhebung einer Gestaltungsklage oder einer Leistungsklage verfolgen könnte oder hätte verfolgen können. Dabei implizieren Gestaltungs- und Leistungsklagen jeweils eine Feststellung. Denn bei der Anfechtungsklage als Gestaltungsklage wird implizit festgestellt, ob ein Verwaltungsakt hätte erlassen werden dürfen. Und die Leistungsklage trifft auch eine Aussage darüber, ob ein Anspruch auf die betreffende Leistung besteht. Vor diesem Hintergrund dient die Subsidiaritätsklausel der Prozessökonomie: Es gilt zu verhindern, dass zunächst lediglich eine Feststellung getroffen wird und nach erfolgreicher Feststellung in einem zweiten Schritt eine Gestaltungs- oder Leistungsklage erhoben wird. Ferner soll die Subsidiaritätsklausel ausschließen, durch die Feststellungsklage die Sachentscheidungsvoraussetzungen anderer Klagearten zu unterlaufen. Insbesondere soll ein in Bestandskraft erwachsener Verwaltungsakt auch keiner Feststellungsklage mehr zugänglich sein.
120
Allerdings gibt es Ausnahmenvon der Subsidiarität der Feststellungsklage. Eine ausdrückliche Ausnahme enthält § 43 Abs. 2 S. 2 VwGO für die Nichtigkeitsfeststellungsklage. Denn bei einem nichtigen Verwaltungsakt kommt grds. (s.o. Rn. 79) keine Anfechtungsklage in Betracht, so dass auch deren Sachentscheidungsvoraussetzungen nicht umgangen werden können. Darüber hinaus ist in der Rechtsprechung eine ungeschriebene Ausnahme in Form der oftmals so bezeichneten „Ehrenmanntheorie“anerkannt: Danach kommt bei Leistungsklagen gegen die öffentliche Hand § 43 Abs. 2 VwGO nicht zur Anwendung, da sich ein Hoheitsträger auch schlichten Feststellungen der Verwaltungsgerichte beuge und auch keine Umgehungsgefahr bestehe[1]. Eine derart weit verstandene Ausnahme steht jedoch in Widerspruch zur Wertung des Gesetzgebers und wird daher im Schrifttum ganz überwiegend abgelehnt[2]. Lediglich im Bereich des sog. Kommunalverfassungsstreits wird diese Ausnahme auch im Schrifttum überwiegend anerkannt (s.u. Rn. 171)[3].
[1]
Etwa bei BVerwG, NJW 1997, 2534 (2535).
[2]
Deutlich Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 5 f. mwN.
[3]
Burgi , Kommunalrecht, 6. Aufl. 2019, § 14 Rn. 11.
3. Die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen
a) Das Feststellungsinteresse
121
Die Feststellungsklage erfordert als besondere Sachentscheidungsvoraussetzung, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat, § 43 Abs. 1 VwGO. Diese Voraussetzung ist eine spezielle Ausformung des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses[1] und dient dazu, einen konkreten individuellen Bezug des Klägers zum Klagegegenstand anzuzeigen und somit die Erhebung einer Popularklage auszuschließen. Das Feststellungsinteresse verhindert ferner, dass die Parteien das Verwaltungsgericht als „Rechtsberatungsstelle“ nutzen. An das Feststellungsinteresse sind allerdings keine allzu hohen Forderungen zu stellen: Jedes schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Artreicht aus, um diese Zulässigkeitsvoraussetzung zu erfüllen[2]. Bemerkenswerterweise werden teilweise die zum berechtigten Interesse bei der Fortsetzungsfeststellungsklage entwickelten Fallgruppen (s.u. Rn. 131 ff.) nicht auch im Rahmen der allgemeinen Feststellungsklage herangezogen[3]. Da in beiden Fällen jeweils ein berechtigtes Interesse vorliegen muss, sollten diese Fallgruppen aber auf die allgemeine Feststellungsklage übertragen werden[4].
122
Besondere Anforderungen gelten bei der Feststellung eines vergangenen oder zukünftigen Rechtsverhältnisses. Liegt das Rechtsverhältnis in der Vergangenheit, ist zu prüfen, ob noch anhaltende Wirkungen in die Gegenwart bestehen. Darüber sind zwar auch zukünftige Rechtsverhältnisse grundsätzlich feststellungsfähig (s.o. Rn. 117). Allerdings müssen sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt hinreichend verdichtet haben. Anderenfalls handelt es sich um eine grundsätzlich unzulässige vorbeugende Feststellungsklage[5].
[1]
Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 363.
[2]
Beispiele bei Detterbeck , AllgVerwR, 18. Aufl. 2020, Rn. 1402.
[3]
So etwa bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 13 einerseits und Rn. 47 andererseits.
[4]
Kopp/Schenke , VwGO. 26. Aufl. 2020, § 43 Rn. 23.
[5]
Erbguth/Guckelberger , AllgVerwR, 10. Aufl. 2020, § 10 Rn. 13.
123
Bei der Feststellungsklage ist umstritten, ob analog § 42 Abs. 2 VwGO die Klagebefugnis zu fordern ist. In der Rechtsprechung wird dies grundsätzlich bejaht, da auch insoweit Popularklagen ausgeschlossen werden müssten[1]. In der Literatur wird dies zu Recht überwiegend abgelehnt. Denn die eine Popularklage ausschließende Filterfunktion wird bereits durch das Feststellungsinteresse bewirkt (s.o. Rn. 121)[2]. Da dort auch wirtschaftliche oder ideelle Interessen ausreichen, mag die Filterwirkung zwar schwächer sein als bei der Klagbefugnis. Dies ist allerdings gerechtfertigt, weil die Wirkung einer feststellenden Entscheidung weniger intensiv ausfällt als bei Gestaltungs- oder Leistungsklagen: Es wird weder gestaltet noch verpflichtet, sondern lediglich festgestellt. Für die Klausurbearbeitungist zu beachten, dass dieser Streitstand zumeist nicht entschieden werden muss, weil die Anforderungen des § 42 Abs. 2 VwGO oftmals erfüllt sind.
[1]
BVerwGE 99, 64 (66).
[2]
Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 17 mwN.
III. Erläuterungen zum Aufbauschema – Begründetheit der Feststellungsklage
124
Der Obersatz ist aus § 43 Abs. 1 VwGO abzuleiten: Die allgemeine Feststellungsklage ist begründet, wenn das in Frage stehende Rechtverhältnis besteht bzw. nicht besteht (§ 43 Abs. 1, 1. Alt. VwGO). Die Nichtigkeitsfeststellungsklage ist begründet, wenn der betreffende Verwaltungsakt nichtig ist (§ 43 Abs. 1, 2. Alt. VwGO). Sofern Anhaltspunkte für einen etwaigen Teilerfolg vorliegen, empfiehlt es sich auch hier, die Konjunktion „wenn“ durch ein „soweit“ zu ergänzen. Denn Rechtsverhältnisse können auch teilweise bestehen, Verwaltungsakte teilnichtig sein (vgl. § 44 Abs. 5 VwVfG).
2. Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses
125
Die allgemeine Feststellungsklage ist begründet, wenn entsprechend der Behauptung des Klägers das Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht. Ist etwa ein Bauherr der Überzeugung, sein Vorhaben sei entgegen der Ansicht der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nicht genehmigungspflichtig, ist zu prüfen, ob der eine Genehmigungspflicht besteht[1].
[1]
Zur Reichweite der Genehmigungspflicht in den einzelnen Bundesländern Kersten , in: Schoch (Hrsg.), BesVerwR, 2018, Kap. 3 Rn. 404 ff.
3. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts
Читать дальше