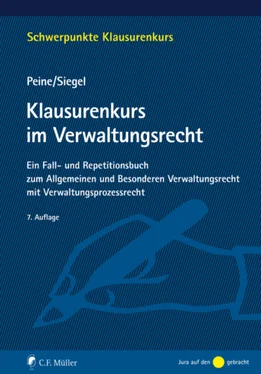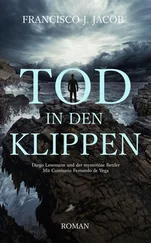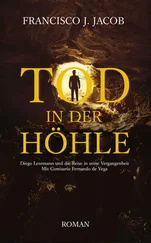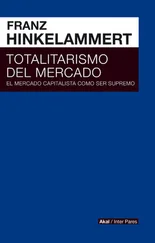96
Im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeitwerden die Zuständigkeit der Behörde, die Einhaltung von Verfahrensbestimmungen, von Formanforderungen sowie des Begründungsgebots geprüft. Hinsichtlich der Einzelheiten kann auf die einschlägigen Lehrbücher zum allgemeinen Verwaltungsrecht verwiesen werden[1]. Auch die etwaige Heilung von Verfahrens- und Formfehlern insbesondere nach § 45 VwVfGist in diesem Zusammenhang zu erörtern. Für die Klausurbearbeitungist zu beachten, dass in der formellen Rechtmäßigkeit regelmäßig kein Prüfungsschwerpunkt liegt und zu erörternde Probleme regelmäßig im Sachverhalt angesprochen werden.
97
In der Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeitliegt hingegen regelmäßig ein, wenn nicht sogar der Prüfungsschwerpunkt einer Anfechtungsklage[2]. Hier ist grundsätzlich zu prüfen, ob der Tatbestandder Ermächtigungsgrundlage erfüllt ist. Insoweit ist auch auf einen etwaigen Beurteilungsspielraumeinzugehen[3]. Kommen mehrere Adressaten für einen Verwaltungsakt in Betracht – dies ist insbesondere bei polizeirechtlichen Klausuren der Fall – so schließt sich die Prüfung an, ob die Maßnahme sich gegen den richtigen Adressatengerichtet ist[4].
98
Schließlich ist im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit auf die Rechtsfolgeeinzugehen. Hier ist zu unterscheiden zwischen gebundenen Entscheidungen und Ermessensentscheidungen. Um eine gebundene Entscheidung handelt es sich etwa bei einer Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit nach § 35 GewO[5]. Belastende Verwaltungsakte ergehen jedoch regelmäßig nach Ermessen der zuständigen Behörde. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen nach dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht[6]. Dann ist zu prüfen, ob ein Ermessensfehlervorliegt[7]. Schließlich muss bei der Prüfung eines Verwaltungsakts auch die Vereinbarkeit mit sonstigen Rechtsgrundsätzen geprüft werden[8]. Hat die Behörde jedoch auf der Rechtsfolgenseite ein Ermessen, so sind diese Grundsätze grundsätzlich bei der Ermessenausübung zu berücksichtigen und steuern damit das Ermessen. Dies gilt insbesondere für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit[9].
[1]
Etwa Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 470 ff.
[2]
Hierzu etwa Maurer/Waldhoff , AllgVerwR, 20. Aufl. 2020, § 10 Rn. 47 ff.
[3]
Hierzu Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, 194 ff.
[4]
Hierzu Schoch , in: ders. (Hrsg.), BesVerwR, 2018, Kap. 1 Rn. 423 ff.
[5]
Hierzu Ziekow , Öffentliches Wirtschaftsrecht, 5. Aufl. 2020, § 10 Rn. 60.
[6]
Hierzu Schoch , in: ders. (Hrsg.), BesVerwR, 2018, Kap. 1 Rn. 302 ff.
[7]
Hierzu Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 206 ff.
[8]
Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 531 ff.
[9]
So am Beispiel des Polizeirechts Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 3 Rn. 128.
5. Verletzung klägerischer Rechte
99
Den letzten Prüfungspunkt im Rahmen der Begründetheit bildet die Verletzung der Rechte des Klägers, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO. Dadurch unterscheidet sie sich von der Normenkontrolle nach § 47 VwGO, bei welcher im Rahmen der Begründetheit keine Verletzung subjektiver Rechte zu prüfen ist (s.u. Rn. 163). Wurde zuvor die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts festgestellt, so ist die Anfechtungsklage allerdings bereits aus diesem Grunde unbegründet. Da niemand durch rechtmäßige Maßnahmen in seinen Rechten verletzt sein kann, erübrigt sich eine zusätzliche Prüfung der Verletzung subjektiver Rechte. Wurde zuvorhingegen die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts festgestellt, so muss zumindest kurz die damit verbundene Rechtsverletzung festgehalten werden. Im Rahmen der Rechtsverletzung ist auch auf die etwaige Unbeachtlichkeit von Verfahrens- und Formfehlern nach § 46 VwVfGeinzugehen. Denn die Unbeachtlichkeit bewirkt nicht die Rechtmäßigkeit, sondern schränkt den Aufhebungsanspruch ein („kann nicht alleine deshalb beansprucht werden“)[1]. Bei Drittanfechtungsklagenist die Reichweite drittschützender Bestimmungen regelmäßig bereits im Rahmen der Klagebefugnis zu erörtern (s.o. Rn. 86) und die Verletzung drittschützender Rechte ebenfalls am Ende der Begründetheitsprüfung festzustellen. Sollte die abschließende Behandlung im Rahmen der Klagebefugnis nicht erfolgt sein, wäre dies nun nachzuholen, gegebenenfalls in einem Hilfsgutachten.
[1]
Hufen/Siegel , Fehler im Verwaltungsverfahren, 6. Aufl. 2018, Rn. 989.
2. Teil Repetitorium im Verwaltungsprozessrecht› 3. Kapitel Rechtsbehelfe in der Hauptsache› B. Die Verpflichtungsklage
B. Die Verpflichtungsklage
100
Teil 1: Sachentscheidungsvoraussetzungen einer Verpflichtungsklage
| 1. |
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs – § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO |
| 2. |
Die Verpflichtungsklage als statthafte Verfahrensart – § 42 Abs. 1, 2. Alt. VwGO |
| 3. |
Verfahrensartabhängige Sachentscheidungsvoraussetzungen a) Klagebefugnis – § 42 Abs. 2 VwGO b) Vorverfahren – §§ 68 ff. VwGO c) Klagefrist – § 74 Abs. 1 VwGO |
| 4. |
Sachliche, instanzielle und örtliche Zuständigkeit des Gerichts – §§ 45 ff. VwGO |
| 5. |
Beteiligtenbezogene Sachentscheidungsvoraussetzungen – §§ 61 ff. VwGO |
| 6. |
Ordnungsgemäße Klageerhebung – §§ 81 ff. VwGO |
| 7. |
Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis |
| 8. |
Fehlen der Rechtshängigkeit und einer rechtskräftigen Entscheidung |
Teil 2: Begründetheit einer Verpflichtungsklage
| 1. |
Obersatz |
| 2. |
Passivlegitimation |
| 3. |
Benennung der Anspruchsgrundlage |
| 4. |
(Formelle und materielle) Anspruchsvoraussetzungen |
| 5. |
Spruchreife |
II. Erläuterungen zum Aufbauschema – Sachentscheidungsvoraussetzungen
1. Statthaftigkeit und Arten der Verpflichtungsklage
101
Die Verpflichtungsklage ist eine besondere Leistungsklage. Sie ist von der allgemeinen Leistungsklage dadurch abzugrenzen, dass eine spezifische Leistung, nämlich ein begünstigender Verwaltungsakt, begehrt wird (s.o. Rn. 61). Sie bildet damit das spiegelbildliche Gegenstück zur Anfechtungsklage, mittels derer ein belastender Verwaltungsakt beseitigt werden soll. Ebenso wie bei der Anfechtungsklage (s.o. Rn. 77) sollte nur in problematischen Fällen vertieft werden, ob es sich um einen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG handelt. So erfüllen behördliche Genehmigungen typischerweise unproblematisch die dort aufgeführten Merkmale. Dies gilt insbesondere für die klausurrelevante Baugenehmigung. Im Zusammenhang mit Nebenbestimmungen wurde bereits darauf hingewiesen, dass nach herrschender und zutreffender Ansicht jede echte Nebenbestimmung mittels einer Anfechtungsklage angegriffen werden kann. Lediglich bei einer „modifizierenden“ Auflage, bei welcher es sich jedoch um keine „echte“ Auflage i.S.d. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG handelt, ist eine Verpflichtungsklage auf Erteilung einer unmodifizierten Genehmigung statthaft (s.o. Rn. 80). Entspricht die Erteilung einer Genehmigung dem klägerischen Begehren (s.o. Rn. 63), so fehlt einer gegen die Aufhebung der Ablehnungsentscheidung gerichteten isolierten Anfechtungsklagegrundsätzlich das Rechtsschutzbedürfnis[1].
Читать дальше