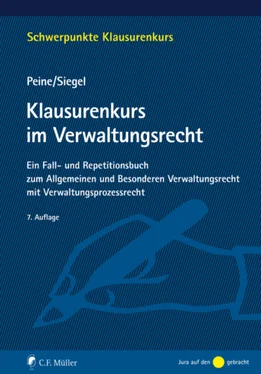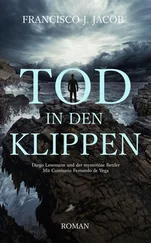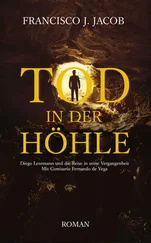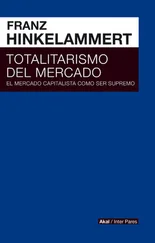87
§ 68 Abs. 1 S. 1 VwGO verlangt vor Erhebung der Anfechtungsklage grundsätzlichdie ordnungsgemäße und im Ergebnis erfolglose Durchführung eines Vorverfahrens/Widerspruchsverfahrens (zur Prüfung eines Widerspruchs s.u. Rn. 209 ff.). Die erfolglose Durchführung eines Vorverfahrens bildet damit eine Sachentscheidungsvoraussetzung. Wenn problemlos die Feststellung möglich ist, dass das Vorverfahren durchgeführt wurde, muss dies in der Bearbeitung kurz festgestellt werden.
88
Vom zuvor dargelegten Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen. So bedarf es nach § 68 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VwGO grds. keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren, wenn dieser von einer obersten Bundesbehörde oder obersten Landesbehörde erlassen worden ist. Das Gleiche gilt gemäß § 68 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 VwGO, wenn der Abhilfebescheid oder Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält[1]. Vor allem aber kann der Gesetzgeberdie Entbehrlichkeit bestimmen. Von dieser Möglichkeit hat der Bundesgesetzgeber etwa Gebrauch gemacht in § 70 VwVfG. Danach bedarf es bei förmlichen Verwaltungsverfahren und wegen der Verweisung in § 74 Abs. 1 VwVfG auch bei Planfeststellungsverfahren keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. Darüber hinaus haben auch einige Bundesländer – darunter einige große Flächenstaaten – das Widerspruchsverfahren durch Landesgesetz zumindest grundsätzlich abgeschafft. Die überwiegende Anzahl der Bundesländer hat es jedoch beibehalten[2].
89
Nach der Rechtsprechung bedarf es darüber hinaus keines Vorverfahrens, wenn der beklagte Verwaltungsträger sich im gerichtlichen Verfahren zur Sache äußert[3]. Diese Rechtsprechung sieht sich jedoch der berechtigten Kritik des Schrifttums ausgesetzt, da die gesetzlich normierte Durchführung des Vorverfahrens nicht zur Disposition der Widerspruchsbehörde stehe[4].
[1]
Zu diesen Ausnahmen Kopp/Schenke , VwGO, 26. Aufl. 2020, § 68 Rn. 19 f.
[2]
Übersicht bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 5 Rn. 5.
[3]
BVerwGE, 66, 39 (41).
[4]
Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 717; Ziekow , in: Sodan/Ziekow, GK ÖR, 9. Aufl. 2020, § 92 Rn. 6.
c) Einhaltung der Klagefrist
90
Weitere Voraussetzung der zulässigen Erhebung einer Anfechtungsklage ist die Einhaltung der Klagefrist. Nach § 74 Abs. 1 VwGO muss die Klage einen Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheidserhoben werden. Die erwähnte Ein-Monatsfrist berechnet sich auf folgende Weise: § 57 Abs. 2 VwGO verweist auf die §§ 222, 224 Abs. 2 und 3, §§ 225, 226 ZPO. Nach § 222 Abs. 1 ZPO gelten für die Berechnung der Fristen die Vorschriften des BGB, also §§ 187 bis 193 BGB. Den Fristbeginn bestimmt § 187 BGB; hier gilt regelmäßig Absatz 1. Das Ende der Frist regelt § 188 BGB; hier gilt Absatz 2. Häufig stellt sich bei Klausuren das Problem der Fristüberschreitung. In diesem Fall ist an § 222 Abs. 2 ZPO zu denken: Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags. Fairerweise wird dann aber im Sachverhalt darauf hingewiesen, dass der Ablauf auf einen solchen Tag fällt.
91
Auswirkungen auf die Klagefrist kann auch die Rechtsbehelfsbelehrunghaben, die seit 2013 nach § 37 Abs. 6 VwVfG grundsätzlich vorgeschrieben ist[1]. Denn Folge einer fehlenden oder unrichtig erteilten Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht etwa, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig wäre, sondern die Verlängerung der Ein-Monatsfrist nach § 74 Abs. 1 S. 1 VwGO auf ein Jahr: § 58 Abs. 2 S. 1 VwGO[2]. Typische Fehler betreffend die Rechtsmittelbelehrung sind die Folgenden: 1. ihr völliges Fehlen, 2. unrichtige Belehrung über a) den Adressaten des Rechtsmittels, b) dessen Sitz, c) die einzuhaltende Frist, d) die einzuhaltende Form[3], 3. nicht vorgeschriebene Hinzufügungen, soweit sie geeignet sind, die Erhebung des Rechtsbehelfs in nennenswerter Weise zu erschweren[4].
[1]
Hierzu Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 519.
[2]
Ensprechendes gilt nach § 70 Abs. 2 iVm § 58 Abs. 2 S. 1 VwGO für die Widerspruchsfrist.
[3]
Zu den Auswirkungen der Anerkennung der elektronischen Einlegung auf die Rechtsbehelfsbelehrung Siegel , JURA 2020, 920 (929).
[4]
Kopp/Schenke , VwGO, 26. Aufl. 2020, § 58 Rn. 12.
III. Erläuterungen zum Aufbauschema – Begründetheitsfragen
92
Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Diese Formulierung sollte bei Anfechtungsklagen als Obersatz die Begründetheitsprüfung einleiten. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder zu beobachtender Fehler: Anstelle von „soweit“benutzen Studierende das Wort „wenn“. Das ist deshalb falsch, weil „wenn“ sprachlich nicht die Möglichkeit der Teilaufhebung des Verwaltungsakts ausdrückt.
93
Die Passivlegitimation umschreibt die Legitimation des beklagten Verwaltungsträgers, über den Streitgegenstand zu verfügen. Sie bildet damit das materielle Gegenstück zur passiven Prozessführungsbefugnis und ist im Rahmen der Begründetheit zu prüfen[1]. Die Passivlegitimation ist jedoch nicht in § 78 VwGO geregelt, da diese Bestimmung nach hier vertretener und zugleich überwiegender Ansicht die passive Prozessführungsbefugnis erfasst (s.o. Rn. 66). In der Klausurbereitet die Prüfung der Passivlegitimation jedoch regelmäßig keine Probleme. Denn der (in formeller Hinsicht) passiv prozessführungsbefugte Verwaltungsträger ist in aller Regel zugleich der (in materieller Hinsicht) Passivlegitimierte. Daher ist auf die Passivlegitimation allenfalls knapp einzugehen. In den 27 Fällen dieses Buches wird sie regelmäßig nicht (mehr) behandelt.
[1]
Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 25 Rn. 2.
3. Benennung der Ermächtigungsgrundlage
94
In der normalen Fallkonstellation, wenn der Kläger Adressat eines belastenden Verwaltungsakts ist, ist zuerst zu prüfen, ob eine Ermächtigungsgrundlage für den erlassenen Verwaltungsakt vorliegt. Fehlt sie nämlich, so ist der belastende Verwaltungsakt wegen des Vorbehalts des Gesetzesbereits aus diesem Grunde rechtswidrig[1]. Insbesondere in ordnungsrechtlichen Klausuren kommen oftmals mehrere Ermächtigungsgrundlagen in Betracht. Dann liegt ein Prüfungsschwerpunkt in der Ermittlung der „richtigen“ Ermächtigungsgrundlage. Denn nach dieser bestimmt sich das nachfolgende Prüfprogramm der Rechtmäßigkeit. So ist etwa in einer polizeirechtlichen Klausur zunächst zu prüfen, ob vorrangiges besonderes Gefahrenabwehrrecht einschlägig ist, insbesondere das Versammlungsrecht. Wird dies verneint, so muss geprüft werden, ob es sich um eine Standardmaßnahme handelt (wenn mehrere in Betracht kommen, welche von diesen) oder ob die polizeiliche Generalklausel Ermächtigungsgrundlage ist[2].
[1]
Peine/Siegel , AllgVerwR, 13. Aufl. 2020, Rn. 183.
[2]
Zu diesen Prüfschritten Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 3 Rn. 138 ff.
4. Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts
95
Ist die Ermächtigungsgrundlage gefunden, ist zu prüfen, ob der Verwaltungsakt formell und materiellrechtmäßig erlassen wurde. Im Rahmen einer gewöhnlichen Anfechtungsklage kommt es also nicht darauf an, ob der Verwaltungsakt nichtig ist nach § 44 VwVfG. Allerdings lässt die h.M. auch gegen einen nichtigen VA die Anfechtungsklage zu (s.o. Rn. 79). Dann kommt es im Rahmen der Begründetheit aber ebenfalls lediglich auf die Rechtswidrigkeit an. Auf die Nichtigkeit ist jedoch im Rahmen der Nichtigkeitsfeststellungsklage nach § 43 Abs. 1, 2. Alt. VwGO abzustellen (s.u. Rn. 126).
Читать дальше