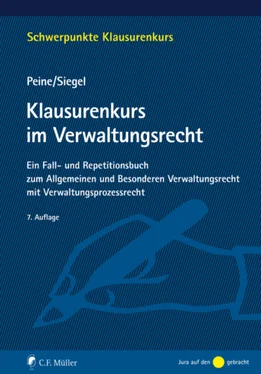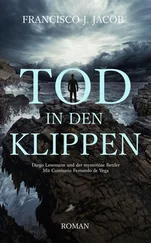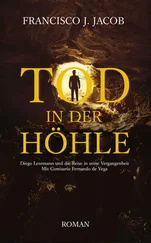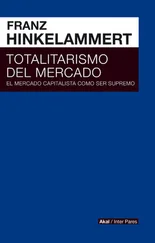| Typ |
Normenkontrolle |
Anordnung/Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs |
Einstweilige Anordnung |
| Gegenstand |
1. Satzungen nach dem BauGB (und gleichgestellte Rechtsverordnungen) 2. sonstige Rechtsverordnungen und Satzungen nach Maßgabe des Landesrechts |
Verwaltungsakt |
Jeder denkbare Gegenstand einschließlich VA, soweit er nicht dem endgültigen Rechtsschutzziel entspricht, mit Ausnahme des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO |
[1]
Hinzu kommt der Antrag auf einstweilige Anordnung im Rahmen einer prinzipalen Normenkontrolle nach § 47 Abs. 6 VwGO; hierzu Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 34. Diese Sonderregelung im Verhältnis zu § 123 VwGO ist allerdings in der Ausbildung kaum bedeutsam.
c) Die Bestimmung des Klage-/Antragsziels
63
Für den Richter ist der vom Kläger gestellte Antrag maßgebend. Ist der Antrag unklar oder falsch formuliert, muss der Richter nach § 88 VwGO den Antrag auslegen[1]: Er hat den wirklichen Willen des Antragstellerszu erforschen. Das Ergebnis muss den gesamten Schriftsatz und das in ihm erkennbar verfolgte Rechtsschutzziel berücksichtigen. Eine Klausur enthält regelmäßig keinen auszulegenden Antrag als Fallfrage. Der Studierende muss einen fiktiven Lebenssachverhalt rechtlich würdigen, der mit der Mitteilung endet, X oder Y habe beim Verwaltungsgericht Klage erhoben. Diesen Informationen muss der Studierende das Begehren des Antragstellers entnehmen. Dann muss er feststellen, welche Klage- bzw. Antragsart dem Begehren der klagenden Person gerecht wird, dem Klagebegehren entspricht (s.o. Rn. 60 ff.). Teilweise wird im Sachverhalt aber bereits eine konkrete Klage-/Antragsart genannt. Dann wird grundsätzlich erwartet, dass diese Verfahrensart durchgeprüft wird. Allerdings kann es auch hier vorkommen, dass die gewählte Verfahrensart nicht dem Begehren des Klägers entspricht. Dann ist dieses Begehren nach § 88 VwGO zu ermitteln.
Beispiel:
Die Polizei schleppt den PKW des A ab. Sie zieht A zu den Kosten heran. A erhebt Klage zum Verwaltungsgericht mit dem Antrag, festzustellen, dass der Kostenbescheid und der Widerspruchsbescheid rechtswidrig sind. Wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden? Es geht A erkennbar nicht um ein Feststellungsbegehren, sondern um die Anfechtung des Kostenbescheids; das Gericht soll ihn aufheben, damit A die Kosten nicht tragen muss.
[1]
Entsprechendes ergibt sich für Antragsverfahren, da § 122 Abs. 1 VwGO auf § 88 VwGO verweist.
III. Die verfahrensartabhängigen = besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen
64
Unter dem Begriff „besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen“ werden – wie gesagt – diejenigen Sachentscheidungsvoraussetzungen zusammengefasst, die nur für bestimmte Verfahrensartengelten. Sie sind erst dann zu prüfen, wenn feststeht, welches Verfahren statthaft ist. Die Bearbeiter*innen müssen sich deshalb die einzelnen Sachentscheidungsvoraussetzungen für die wichtigsten Verfahrensarten einprägen. Die Verfahren, ihre besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen und die Grundzüge der jeweiligen Begründetheitsprüfung werden im Anschluss an das allgemeine Schema einzelnen dargestellt[1].
[1]
Darstellungshinweis für die folgenden Abschnitte:Alle Sachentscheidungsvoraussetzungen unter Einbeziehung der besonderen werden wegen deren grundsätzlicher Gleichrangigkeit auf einer Gliederungsebene dargestellt.
IV. Die sachliche, instanzielle und örtliche Zuständigkeit des Gerichts – §§ 45 ff. VwGO
65
Auch die sachliche, instanzielle und örtliche Zuständigkeit des Gerichts gehört zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen. Sie wird oftmals nach den besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen geprüft, weil die Vorschrift des § 52 VwGO bei der Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit (auch) nach den Klagearten differenziert. In denjenigen Bundesländern, in denen (ausnahmsweise) nur ein Verwaltungsgericht existiert[1], empfiehlt sich allerdings eine Prüfung im Anschluss an die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs (s.o. Rn. 38). Aber auch wenn Ausführungen zur Zuständigkeit erwartet werden, bereitet ihre Bestimmung in Klausuren bis zur Ersten Juristischen Staatsprüfung selten Probleme. Von der sachlichen und zugleich instanziellen Regelzuständigkeit des Verwaltungsgerichts nach § 45 VwGOsollte insbesondere die klausurrelevante Ausnahme nach § 47 Abs. 1 VwGO bekannt sein. Danach ist für die prinzipale Normenkontrolle das OVG (gleichgestellt der VGH) erstinstanzlich zuständig. Ist das Verwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig und existieren in einem Bundesland – dies ist der Regelfall – mehrere Verwaltungsgerichte, so bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 52 VwGO.[2]
[1]
Dies ist etwa in Berlin der Fall, vgl. § 1 Abs. 1 AGVwGO Bln; hierzu Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 2 Rn. 44.
[2]
Hierzu Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 11 Rn. 81 ff.
V. Die beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzungen – §§ 61 ff. VwGO
1. Vorfrage des richtigen Klage-/Antragsgegners
66
Die beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzungen sind in §§ 61 ff. VwGO geregelt. Zu unterscheiden sind die Beteiligtenfähigkeit nach § 61 VwGO, die Prozessfähigkeit nach § 62 VwGO sowie die Postulationsfähigkeit nach § 67 VwGO. Zuvor muss jedoch der richtige Klagegegner bzw. Antragsgegner ermittelt werden. Denn erst wenn dieser benannt ist, kann dessen Beteiligten- und Prozessfähigkeit bestimmt werden[1]. Dies führt zur Anschlussfrage der passiven Prozessführungsbefugnis. Sie ist für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen in § 78 VwGOgeregelt. Diese Bestimmung wird zwar teilweise als Regelung der Passivlegitimation erachtet[2]. Für eine Zuordnung der Vorschrift zur passiven Prozessführungsbefugnis sprechen aber bereits der Wortlaut („ist zu richten“) sowie die systematische Einordnung im Rahmen der anderen Sachentscheidungsvoraussetzungen. Zudem ergibt sich die Passivlegitimation aus materiellem Recht, wozu der Bund nicht die umfassende Gesetzgebungskompetenz besäße[3].
67
In der Bestimmung des § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGOkommt der allgemeine Grundsatz zum Ausdruck, dass Klagen grundsätzlich gegen den betreffenden Rechtsträger zu richten sind, also insbesondere Bund, Land oder eine Gemeinde (Rechtsträgerprinzip). Allerdings gestattet § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO den Bundesländern, durch Landesgesetz das Behördenprinzipzu normieren. Von dieser Möglichkeit haben einige, nicht jedoch alle Bundesländer Gebrauch gemacht[4]. Der unmittelbare Anwendungsbereich des § 78 VwGO ist allerdings beschränkt auf Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen. Aber auch bei den anderen Verfahrensarten ist zumindest grds. das Rechtsträgerprinzip einschlägig. Bei den mit der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage „verwandten“ Verfahrensarten, also der Fortsetzungsfeststellungsklage, sowie dem vorläufigen Rechtsschutz nach §§ 80, 80a VwGO und nach § 123 VwGO, kann dieses Ergebnis einer analogen Anwendung des § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO entnommen werden. Im Übrigen ist auf das allgemeine Rechtsträgerprinzip zurückzugreifen.
[1]
Detterbeck , AllgVerwR, 18. Aufl. 2020, Rn. 1338.
[2]
So etwa Würtenberger/Heckmann , VwProzR, 4. Aufl. 2018, Rn. 683.
Читать дальше