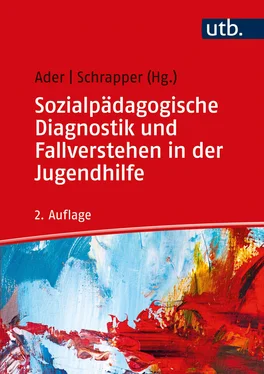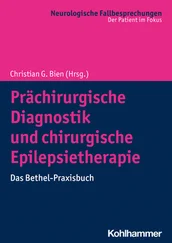Eine neue Tochter wird geboren.
Zugleich aber deutet sie an, ohne es deutlich auszusprechen, dass sie sich nicht mehr um die beiden älteren Enkeltöchter kümmern könne, denn jetzt brauche sie ihre eigene Tochter dringend, die am 1. Januar eine weitere Tochter geboren habe.
Mit diesen Informationen soll die zuständige Fachkraft des Jugendamtes / ASD nun entscheiden, was sie mit den Mitteln und Möglichkeiten der Jugendhilfe tun kann, um Versorgung, Betreuung und Erziehung von Elsa und Maria zukünftig zu sichern.
Welche Aufgaben stellen sich hier generell – und für wen?
Für die zuständige Fachkraft eines Jugendamtes / ASD stellen sich in einer solchen Situation viele Fragen und gleichzeitig ist sie mit deutlichen Erwartungen konfrontiert:
■Wo können Elsa und Maria längerfristig leben?
– Doch wieder bei ihrer Mutter, dem neuen Partner und den beiden kleinen Halbschwestern, aber nicht mehr in ihrer bisherigen Umgebung mit Schule und FreundInnen
– oder doch besser bei der Großmutter? Hier haben sie FreundInnen und Kontakte, gehen zur Schule – aber ihre Großmutter ist erschöpft und will sich um die neuen Kinder ihrer Tochter kümmern und diese mit den kleinen Mädchen unterstützen.
■Alle Familienmitglieder, auch Elsa und Maria, sind sehr zurückhaltend und vorsichtig dem Jugendamt gegenüber und haben bisher auch ein Jugendamt erlebt, das ihnen gegenüber eher verhalten reagiert hat. Wie kann der neuen Fachkraft ein eigener und interessierter Zugang gelingen, ohne die Mädchen einzuschüchtern, aber auch ohne Versprechungen zu machen, die sie nicht halten kann?
■der Vormund schwankt zwischen dem Wunsch, in seinen Rechten ernst genommen zu werden (Aufenthaltsbestimmungsrecht) und der Resignation, dass die Familie doch tut, was sie für richtig hält. Auch erwartet er die Loyalität seiner neuen ASD-Kollegin.
■die KollegInnen sowie die Leitung des ASD-Teams erwarten von der jungen Kollegin vor allem, dass sie sich nicht so lange mit einem Fall aufhält, der nicht so dringend erscheint, da viele andere und dringendere Fälle auf sie warten.
Aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe ist die Situation von Elsa, Maria und ihrer Familie ein „Fall“ mit definierten Aufgaben und Zuständigkeiten für Kinder und Eltern, mit einem konkreten Anlass und deutlichen Erwartungen, aber auch ein Fall mit Geschichte und Hintergründen. Aus der konkreten eigenen Sichtweise und Einschätzung der zuständigen Sozialarbeiterin im ASD geht es im Fall zunächst vor allem um folgende Fragen und Herausforderungen:
Fragen sozialpädagogischer Diagnostik
■Wie können Vielfalt und Komplexität mit Blick auf „das wirkliche Leben“ von Elsa, Maria, ihrer Großmutter, aber auch ihrer Mutter und deren neuer Familie sowie ihre Erwartungen an das Jugendamt systematisch erfasst und bedacht werden, ohne den Überblick zu verlieren, aber auch ohne etwas Wichtiges zu übersehen?
■Wie kann sie die Erfahrungen der bisher mit diesem Fall befassten Fachkräfte in ihrem Jugendamt verstehen und einordnen, insbesondere des mit ihr für die beiden Mädchen zuständigen Vormunds sowie der für die Verwandtenpflege zuständigen Fachkraft des Pflegekinderdienstes?
■Und wie kann dieses im Prozess entstehende komplexe Bild anschließend wieder entscheidungs- und handlungsorientiert reduziert werden, damit auch konkrete Antworten gefunden werden, was zu tun und was zu lassen ist?
Wann wird ein Fall zum Fall?
Eine wichtige Voraussetzung für Fallverstehen und Diagnostik wird bereits deutlich: Zu einem Fall für die Jugendhilfe werden (problematische) Lebensgeschichten, materielle und soziale Lebenslagen und konkrete Lebenssituationen erst, wenn sie professionell beschrieben, also als Fall definiert, und dann bearbeitet werden. Ein solcher Fall ist nie eine Lebenssituation allein, sondern immer die damit verbundene spezifische Mischung aus akuter Situation, Lebens- und Hilfegeschichte und rechtlich bestimmten Aufgaben und Zuständigkeiten. Und diese Komplexität gilt es für sozialpädagogische Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, hier für die Sozialarbeiterin eines Jugendamtes, zu durchblicken und zu verstehen ( Kap. 2.2):
■Zum einen die Mischung aus (1) aktueller Situation, meist verbunden mit akuten Anfragen, Sorgen und Problemen, aus (2) Geschichte und Geschichten aller Beteiligten und aus (3) den konkreten Aufgaben und Zuständigkeiten in und für diesen Fall.
■Zum anderen die Position als sozialpädagogische Fachkraft im Blick auf die konkreten Menschen, deren Lebenssituation, Erwartungen und Befürchtungen ebenso wie auf die eigenen gesetzlichen Aufträge und die organisatorische Verfassung als Teil eines professionellen Dienstes.
Wozu einen Fall verstehen?
Verständnis und Durchblick sind in diesem Zusammenhang für die Sozialarbeiterin eines zuständigen Jugendamtes allerdings kein Selbstzweck, sondern sollen auftragsgemäßes Handeln nachvollziehbar begründen und anleiten, also Entscheidungen über Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – hier für Elsa, Maria, ihre Großmutter und ggf. weitere Familienmitglieder – vorbereiten. Zu den gesetzlichen Aufträgen der Kinder- und Jugendhilfe gehört es auch, nicht nur nach geeigneter und annehmbarer Unterstützung und Hilfe zu suchen, sondern zu prüfen, ob zum Schutz vor Gefahren für das Wohl eines konkreten Kindes auch gegen den Willen der Eltern eingegriffen werden muss – hier z. B. ob von den dem Vormund unbekannten Aufenthalten zwischen den Haushalten der Großmutter und der Mutter akute Gefährdungen ausgehen und ob gegen den Willen der sorgeberechtigen Mutter eine stationäre Unterbringung erforderlich wird. Wie alle mit Zwang verbundenen Handlungen sind solche Eingriffe in das „natürliche Recht der Eltern“ (Artikel 6 GG) besonders streng zu prüfen und besonders fundiert zu begründen. Auch dies ist eine Aufgabe für Fallverstehen und Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe.
Zusammenfassung
1.Verstanden werden wollen Kinder und Eltern als konkrete und lebendige Menschen mit ihren Erfahrungen und Lebensumständen, Erwartungen und Interessen.
2.Ebenso verstanden werden müssen die komplexen und oft komplizierten Aufgaben und Aufträge der Kinder- und Jugendhilfe sowie ihre Arbeitsweisen und Organisationsformen in den Auswirkungen auf die konkreten Menschen und Situationen.
3.Und nicht zuletzt müssen sich die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer beruflichen Rolle und Kompetenz verstehen und dabei ihre persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen über Kindheit und Elternschaft, damit verbundene Rechte und Pflichten sowie ihre Stärken und Schwächen in Zugang und Kommunikation in den Blick nehmen.
Warum und wozu Eltern und Kinder verstehen? Rahmen und Auftrag für Fallverstehen und die Diagnostik der Kinder- und Jugendhilfe
Fremdverstehen und Selbstverstehen
Fallverstehen und Diagnostik werden in diesem Buch als ein umfassendes Konzept vorgestellt, das die sachliche Analyse erkennbarer Fakten ebenso umfasst wie das Nachvollziehen und Einfühlen-Können in emotionale Verfassungen und Prägungen. Es geht also um ein Konzept, das den Blick auf andere, hier vor allem Kinder und Eltern, auf ihre Lebensumstände, Interessen und Bedürfnisse ebenso beinhaltet wie den Blick auf die eigene Person als Fachkraft und als Mitarbeitende in einer Organisation. Es geht um Fremdverstehen ebenso wie um Selbstverstehen, denn nur aus beiden Perspektiven zusammen zeigt sich, was konkret der Fall ist, und was in diesem Fall von einer konkreten Fachkraft getan werden kann bzw. muss und was besser nicht.
Der Rahmen ...
Bevor in Kapitel 2diese Konzeption von Fallverstehen und Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe differenziert vorgestellt wird, soll hier vorab eine zentrale Voraussetzung dafür erläutert werden: Warum überhaupt sollen und wollen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe Eltern und Kinder verstehen?
Читать дальше