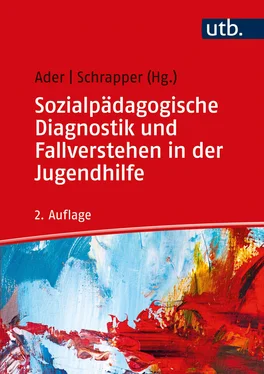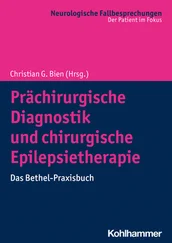Das Buch richtet sich vorrangig an Lehrende und Studierende sowie an Fachkräfte aus der Praxis. Und bestenfalls ist es darüber hinaus ein Beitrag zum weiterhin zu führenden fachtheoretischen Diskurs.
Neben den AutorInnen der Beiträge in Kapitel 4 danken wir auch Magdalena Megler für die redaktionelle Arbeit am Manuskript sowie Ann-Sophie Kuhn als studentischer Mitarbeiterin für ihre sorgfältigen Literaturrecherchen herzlich.
Ebenso geht unser Dank an viele KollegInnen in der Praxis der Jugendhilfe für gemeinsame Reflexions- und Lernprozesse. Eine Qualifizierung von sozialpädagogischem Fallverstehen und Diagnostik in der Profession halten wir für dringend geboten. Nicht gelingende Hilfeprozesse sind mitunter ein bedrückender Beleg für unzureichende Verstehensleistungen. Und dennoch zeigt sich in der Vermittlung und Weiterentwicklung des hier vorgestellten Konzeptes auch immer wieder der hohe persönliche Einsatz und das Engagement von Fachkräften in der Arbeit mit vernachlässigten und verletzten Kindern sowie Eltern, die oftmals ebenso verletzte Kinder sind. Die Gratwanderung zwischen Respekt, deutlicher Konfrontation und zugewandter Unterstützung bleibt ein fortwährender Balanceakt für alle Beteiligten.
In dieser 2. Auflage haben wir neben notwendigen Überarbeitungen und Korrekturen vor allem im Kapitel 4.2.1 die doch umfangreichen gesetzlichen Neuerungen zur Hilfeplanung eingearbeitet.
1 Ein exemplarischer Fall – Familie Kramer: Auftrag und Rahmen professioneller Fallbearbeitung in der Jugendhilfe
Als Einführung und erste Annäherung daran, um was es bei Fallverstehen und sozialpädagogischer Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe geht, wird die Fallgeschichte zweier Mädchen und ihrer Familie erzählt, so wie sie tatsächlich bei einer jungen Fachkraft in einem Jugendamt zum Fall wurde – natürlich anonymisiert. An diesem Fall sollen konkret und nachvollziehbar die Fragen und Herausforderungen für die fallanalytische Arbeit, d. h. für das Fallverstehen und die Diagnostik in diesem Handlungsfeld vorgestellt werden. In Kapitel 3wird die Fallgeschichte wieder aufgegriffen, um daran die fachlichen Zugänge und die konkreten methodischen Arbeitsweisen des in diesem Buch vorgestellten und vertretenen Ansatzes differenziert zu erläutern und zu veranschaulichen.
Wo können die Mädchen zukünftig leben?

Elsa und Maria: Welche Unterstützung wird gebraucht?
Es geht um Elsa (14 Jahre) und Maria (12 Jahre). Die beiden Schwestern kennt Frau Maier seit knapp einem Jahr, seit sie als Sozialarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst (nachfolgend: ASD) eines Großstadtjugendamtes zu arbeiten angefangen hat und sofort für die Familie Kramer zuständig geworden ist. Ihre erste Aufgabe ist die Vorbereitung eines Hilfeplangespräches, in dem die Unterbringung der beiden Mädchen in Form einer Verwandtenpflege bei der Großmutter überprüft werden soll. Die Geschwister haben seit fünf Jahren einen Amtsvormund (Anmerkung: Amtsvormünder haben an Eltern statt die oder Teile der elterlichen Sorge inne); zudem ist eine Fachkraft des Pflegekinderdienstes zuständig für das Pflegeverhältnis (gem. § 33 SGB VIII). Aktuell geht es vor allem darum, wo die Mädchen weiterhin leben können, denn erneut hat ihre Mutter ihr Leben weitreichend verändert und ihre Großmutter ist erschöpft.
wechselnde Aufenthaltsorte
Aus den Fallakten erfährt Frau Maier, dass beide Mädchen seit fünfeinhalb Jahren im Rahmen einer offiziellen Verwandtenpflege bei der Großmutter leben, vorher über mehrere Jahre immer wieder wechselnd bei ihrer Mutter oder bei der Großmutter. Vor drei Jahren ist die Mutter in eine andere Stadt, ca. 50 km entfernt, gezogen. Sie lebt dort mit einem neuen Partner zusammen, mit dem sie seit zwei Jahren eine weitere Tochter hat. Nachdem die Kontakte der beiden älteren Töchter mit ihrer Mutter lange Zeit belastet und unregelmäßig waren, gibt es in jüngster Zeit wieder mehr und längere Besuche von Elsa und Maria bei ihrer Mutter, dies nur teilweise mit Wissen und Zustimmung des Amtsvormundes. Elsa hat zudem den Wunsch geäußert, ganz zu der Mutter zu ziehen, auch um diese bei der Versorgung der kleinen Halbschwester zu unterstützen. Nach einem Streit mit der Mutter zieht Elsa diesen Wunsch jedoch zurück und lebt wieder mit ihrer Schwester Maria bei der Großmutter, die aber nun dem Pflegekinderdienst gegenüber deutlicher von ihrer Überforderung mit der Versorgung der beiden Enkeltöchter spricht.
In dieser konkreten Situation ist Frau Maier für den Fall zuständig geworden. Im Hilfeplangespräch gemeinsam mit der Großmutter, den beiden Mädchen sowie dem Amtsvormund und der Fachkraft des Pflegekinderdienstes kann nicht viel geklärt werden, Großmutter und Mädchen sind – wie früher schon – in dem Gespräch sehr verschlossen. Es scheint, dass sie Frau Maier erst einmal kennenlernen müssen, bevor sie sich im Gespräch mehr öffnen. Elsa will aktuell nicht zur Mutter und lieber in der Großstadt, bei ihren Freunden und in ihrer Schule bleiben. Dagegen kann Maria, die jüngere, sich jetzt vorstellen, zur Mutter zu ziehen.
In den folgenden Wochen kommt es mit dem Jugendamt vermehrt zu Streit um den Aufenthalt der beiden Mädchen, weder die Großmutter noch die Mutter wissen teilweise, wo die Mädchen sich aufhalten. Der Amtsvormund stellt fest, dass die Kinder nicht bei der Oma sind und meldet sie bei der Polizei als vermisst. Diese kann sie jedoch im Haus der Mutter ebenfalls nicht finden. Die Mutter gibt an, nicht zu wissen, wo sie sich aufhalten. Am Tag darauf tauchen beider wieder bei der Großmutter in der Großstadt auf und erzählen, sich auf dem Dachboden im Haus der Mutter versteckt zu haben.
Notfallplan wird erarbeitet
In einem erneuten Hilfeplangespräch mit der Großmutter wird zum einen ein konkreter „Notfallplan“ dazu vereinbart, wie sie zukünftig dem Amtsvormund mitteilt, wenn die Kinder nicht bei ihr sind und die Mutter besuchen (Aufenthaltsbestimmungsrecht des Amtsvormunds). Zudem schlagen die Fachkraft des Pflegekinderdienstes und die neue fallzuständige Fachkraft des ASD, Frau Maier, der Großmutter ein sogenanntes Elterncoaching sowie eine aufsuchende Familientherapie vor, um die Belastungen und Probleme im Umgang mit den beiden Mädchen zu „bearbeiten“. In diesem Gespräch offenbart die Großmutter, dass beide Mädchen Kontakt zu ihren (unterschiedlichen) Vätern haben, Maria regelmäßig alle 14 Tage, Elsa seltener, zumal ihr Vater in einer ca. 200 km entfernten Stadt lebt.
Die Großmutter kann nicht mehr.
Gut einen Monat später, im November, sind weder die Großmutter noch die Mädchen trotz vereinbarter Gesprächstermine für etwa eine Woche erreichbar. Danach melden sie sich und erzählen, dass sie alle bei der Mutter waren, die wieder schwanger sei und der sie helfen mussten. Trotz erneuter „Ermahnung“ des Amtsvormunds, den Aufenthalt der Mädchen jederzeit wissen zu müssen, bleiben die Kontakte schwierig. Die Weihnachtszeit steht bevor und die ASD-Fachkraft „ordnet an“, dass danach, spätestens am 3. Januar, alle verbindlich wieder in der Großstadt sind, um sich zu einem erneuten Hilfeplangespräch zu treffen. Denn inzwischen ist auch deutlich geworden, dass weder das Elterncoaching noch die aufsuchende Familientherapie von der Großmutter angenommen werden. Nachdem zwar nicht am 3., aber am 8. Januar tatsächlich Großmutter, beide Mädchen und der Vater von Maria zum Hilfeplangespräch kommen, wird zum einem erzählt, dass die Mädchen über die Weihnachtstage jeweils bei ihren Vätern waren, die Familie also für sie gesorgt habe, eine Dauerlösung sei dies aber auf keinen Fall. Zum anderen wird eine Hilfe in der Familie zur Entlastung der Großmutter von ihr vehement abgelehnt.
Читать дальше