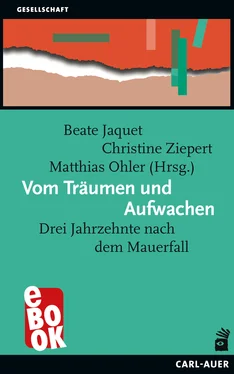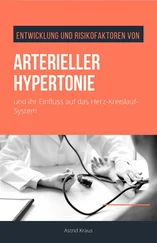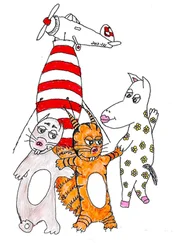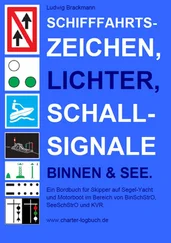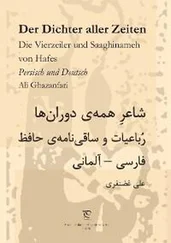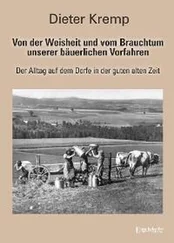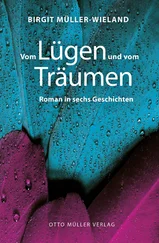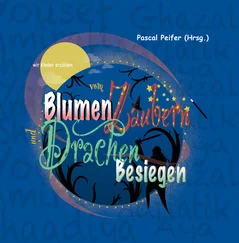In keinem anderen Gesellschaftssystem als der Demokratie ist das Individuum in der Lage, eigenmächtiger und selbstwirksamer zu agieren. Wir dürfen die Menschen dazu einladen, ihre Handlungsspielräume noch intensiver zu nutzen.
Cornelia Stieler ist Systemische Coachin und Therapeutin, Kommunikations- und Betriebspsychologin und Biografietrainerin. Sie ist Gründerin der WaldAkademie Machern bei Leipzig, in der sie sich unter der Marke »OSTZIGARTIG« auf die Begleitung von Menschen mit ostdeutschen Biografien spezialisiert hat. Mithilfe des biografischen Arbeitens bringt sie die Teilnehmenden ihrer Workshops aus Ost- und Westdeutschland in den (politischen) Dialog. Eindrücke aus ihrer Arbeit schildert sie hier im Interview:
Welchen Einfluss hat das politische System, in dem Menschen leben und handeln, auf ihre Biografie?
CORNELIA STIELER Aus meiner Erfahrung wird der Einfluss der gesellschaftlichen Prägung auf die Individualbiografie deutlich unterschätzt. Und zwar gesamtgesellschaftlich ebenso wie individuell. Ein gesellschaftliches System vermittelt eine bestimmte Ideologie, schafft idealerweise Raum für Auseinandersetzungen mit verschiedenen gesellschaftlichen Ansätzen, es prägt Menschenbilder, interpretiert Geschichte und nimmt Einfluss auf die Erziehungssysteme. Eine Diktatur agiert anders als eine Demokratie, greift stark in Erziehung ein, beschneidet das Recht auf selbstbestimmtes Denken und manipuliert die Auseinandersetzung ihrer Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen zu ihren ideologischen Gunsten. Das kann nicht ohne Auswirkungen auf Menschen bleiben. Politik hat in einer Diktatur einen anderen Stellenwert, denn sie ist omnipräsenter, aber oft auch unbeliebter. Menschen gehen je nach Persönlichkeit und Kontext ganz unterschiedlich damit um: Manche arrangieren sich – mit der guten Absicht, für sich und die Familie die bequemste und einträglichste aller Möglichkeiten gewählt zu haben. Andere gehen in den Widerstand, nehmen dafür hohe Risiken in Kauf. Und Weitere entwickeln eine hohe Ignoranz gegen alles Politische und gehen in die Vermeidung. Diese jeweils gelebten Verhaltensweisen sind ein individualbiografisches Gepäck, das die Betroffenen oft auch unhinterfragt weiter mit sich tragen, selbst wenn Kontexte sich ändern, das politische System ein anderes wird.
Welche Unterschiede erleben Sie diesbezüglich bei der Arbeit mit Menschen aus Ost- bzw. Westdeutschland?
CORNELIA STIELER Auch in der westdeutschen Gesellschaft gibt es Menschen, denen politische Themen näher sind, und welche, die Politik mit großem Desinteresse begegnen und in Gesprächen durch Unwissenheit glänzen. Die Ursachen dafür sind nur andere, denn in der Bundesrepublik war es – im Gegensatz zur DDR – nicht unter Strafe gestellt, sich politisch differenziert und breit zu informieren. Wenn Ost- und Westdeutsche miteinander im Dialog über politische Themen sind, ist es vor allem spannend, aus welchen jeweiligen gesellschaftlichen Lagern Menschen aus Ost und West aufeinandertreffen. Treffen desinteressierte und mit Halbwissen ausgestattete Westdeutsche auf gut informierte, einst kritischoppositionelle Ostdeutsche, kann die Mischung genauso schwierig sein, als wenn politisch interessierte, gebildete Westdeutsche und politisch angepasst aufgewachsene Ostdeutsche aufeinandertreffen. Als Ostdeutsche erlebe ich oft bei linksorientierten Westdeutschen völlig idealisierte Sozialismusvorstellungen, bei denen es mich manchmal gruselt. Da wünsche ich mir oft mehr Interesse an der Frage: »Wie war es denn im real existierenden Sozialismus – ganz konkret?« Ich erlebe es noch zu oft, dass Westdeutsche ihr angelesenes Wissen dem gelebten Leben in einer Diktatur entgegensetzen wollen und direkten Dialogen mit Ostdeutschen eher aus dem Weg gehen. Mich beschäftigt die Frage, woran es liegt, dass so wenig Interesse da ist. In Gruppen, in denen mit der Haltung des neugierigen Nichtwissens die Geschichte des anderen erforscht wird, erfahren wir oft sehr viel Neues voneinander. Auch ich lerne immer wieder Neues. Davon wünsche ich mir einfach mehr.
Was verstehen Sie unter gesellschaftspolitischer Selbstwirksamkeit?
CORNELIA STIELER Das bedeutet für mich, ganz konkret im Kleinen zu beginnen, jeder in seinem direkten Umfeld. Bei Gesprächen in der Verwandtschaft, unter Kollegen, mit dem Nachbarn. Ich erlebe, dass viele sich damit schwertun. Viele politische Themen »hängen« förmlich in der Luft, aber den Menschen fehlt teilweise die Kraft, das Interesse oder auch die Gesprächsfähigkeit, miteinander verschiedene Sichtweisen differenziert auszutauschen. Ich habe noch immer das Gefühl, dass Ostdeutsche große Schwierigkeiten haben, Meinungsvielfalt in ihrer direkten Umgebung auszuhalten. Mein Eindruck ist, dass die Diktatur in diesem Punkt tatsächlich ganze Arbeit geleistet hat, weil sie über 40 Jahre lang »Gleichmacherei« zum Ziel erklärt hat. In der DDR gab es nur zwei Kategorien: Freund oder Feind! Diese »Schwarz-Weiß-Denke« hat sich bei großen Teilen der Gesellschaft sehr tief festgesetzt, und es ist ein mühsamer Prozess, es durch ein »Denken in Graustufen« zu ersetzen.
Als wie hoch schätzen die Menschen, mit denen Sie arbeiten, ihre gesellschaftspolitische Selbstwirksamkeit ein?
CORNELIA STIELER Ich mache die Erfahrung, dass nur wenige Menschen in Ostdeutschland sich ihrer eigenen politischen Selbstwirksamkeit bewusst sind. Die Mehrheit der Ostdeutschen war an der friedlichen Revolution auch nicht aktiv beteiligt, sondern eher Zuschauer und Zuschauerinnen, das müssen wir anhand der Zahlen ernüchtert feststellen. Manche wurden maximal zum Mitläufer bzw. zur Mitläuferin, als es nicht mehr so viel Mut brauchte, sich in einer Großdemo einzureihen. Dass aber dennoch mutige Ostdeutsche selbst den Systemsturz herbeigeführt und bereits über viele Jahre Vorarbeit dafür geleistet haben, wurde aus meiner Sicht in den letzten 30 Jahre nicht ausreichend gewürdigt. Auch die vielen kleinen systemdestabilisierenden Aktivitäten in der DDR spielen in der bundesdeutschen Geschichtsschreibung kaum eine Rolle. Doch genau sie sind wichtig dafür, den Menschen einen Zugang zu ihrer eigenen Selbstwirksamkeit aufzuzeigen. Man muss kein großer Revolutionär sein, wenn man bereit ist, auch im Alltag Zivilcourage zu zeigen. Wenn viele das tun, verändert das Gesellschaft auch. Das ist eine Erfahrung, die wir in der DDR gemacht haben. Doch die scheint heute fast in Vergessenheit zu geraten, und das halte ich für problematisch – für ganz Deutschland, denn auch heute wird Zivilcourage gebraucht!
Wodurch lässt sie sich Ihrer Meinung nach steigern?
CORNELIA STIELER Ich versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich in meinen unterschiedlichen Biografieformaten v. a. die unterschiedlichen Gruppen der ostdeutschen Gesellschaft miteinander in den Dialog bringe. Und das sind teilweise sehr berührende, aber auch neue und zum Teil auch verstörende Erfahrungen. Nach 30 Jahren ist die Distanz groß genug dafür, in geschütztem Rahmen Begegnung zu ermöglichen. In meinen Gruppen sitzen oft Kinder von Oppositionellen neben Stasikindern, einstige FDJ-Sekretäre neben Pfarrerstöchtern … Wir lernen inzwischen sehr viel voneinander und beginnen, die DDR aus der Perspektive der jeweils anderen Seite retrospektiv zu begreifen. Daraus erwächst ein gemeinsames Verständnis, was die Diktatur mit und aus uns gemacht hat. Es entstehen Momente, in denen gemeinsam Betroffenheit gezeigt und Verlorenes betrauert werden kann, aber auch gemeinsame Kraft aus der verbindenden Erfahrungswelt entsteht. Wir gehen nie auseinander ohne die Frage, welche Erfahrungen wir in die heutige Gesellschaft zurückspielen können. Und ich bin sehr optimistisch, dass auch diese vielen kleinen punktuellen Bemühungen voranbringen.
Читать дальше