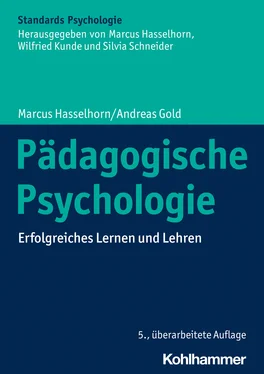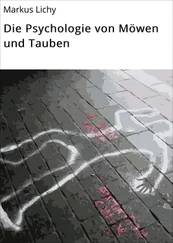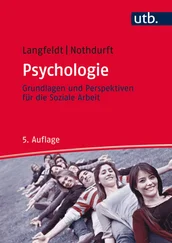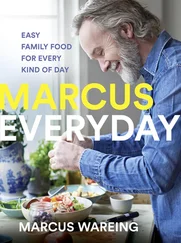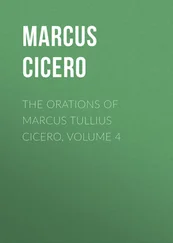Bereits Flavell war von der Bedeutung zweier weiterer Facetten der Metakognition überzeugt, deren Erforschung sich allerdings als vergleichsweise schwierig erwiesen hat. Dabei handelt es sich zum einen um die Sensitivität, zum anderen um die metakognitive Erfahrung. Unter Sensitivität versteht man das Gespür für die derzeit verfügbaren Möglichkeiten eigener kognitiver Aktivitäten. Das ist für eine effiziente Nutzung exekutiver Überwachungsprozesse unerlässlich. Vermutlich kann dieses Gespür sowohl die Folge eines hinreichenden Erfahrungswissens sein als auch der Ausdruck einer »intuitiven« Sensitivität.
Während diese Sensitivität keineswegs bewusst sein muss, versteht man unter den metakognitiven Erfahrungen bewusste kognitive Empfindungen (z. B. »verwirrt sein« über eine scheinbar widersprüchliche Information) oder affektive Zustände bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität (z. B. »bedrückt sein« darüber, dass man eine neue Information nicht versteht).
Im Verlauf eines Lernprozesses kommt es zu einer komplizierten Vernetzung der verschiedenen Subkategorien der Metakognition. Aufgrund dieser Vernetzung ist es oft kaum möglich, die theoretisch unterscheidbaren Aspekte der Metakognition empirisch auseinanderzuhalten. Dennoch erscheint uns die vorgelegte differenzierte Klassifikation sinnvoll und notwendig. Denn erstens kann man nur so den Versuch unternehmen, die Metakognitionen von anderen Konzepten abgrenzen. Und zweitens macht erst eine solche Differenzierung die Beschreibung und Erklärung der mannigfaltigen Einflussnahme von Metakognitionen auf das Lernverhalten möglich.
Noch Anfang der 1980er Jahre war man skeptisch, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Metakognitionen und Lern- und Behaltensleistungen gibt. Dies änderte sich erst, als Schneider (1985) eine erste Metaanalyse vorlegte. Aus 27 Publikationen mit statistischen Zusammenhangsanalysen zwischen Metakognition und Leistungen destillierte er einen mittleren Zusammenhang von r =.41 – ein Ergebnis, das die Zweifel an der Bedeutsamkeit der Metakognitionen für den Lernerfolg auszuräumen vermochte.
Doch wie nehmen Metakognitionen Einfluss auf das Lerngeschehen? Man geht davon aus, dass es nicht nur einen einzigen Wirkmechanismus gibt. Komponenten der verschiedenen Subkategorien von Metakognition können dafür verantwortlich sein, dass beim Bearbeiten einer Lernanforderung eine Reflexion über den eigenen Lernprozess, über den erreichten Wissensstand und über die strategischen Lernmöglichkeiten in Gang gesetzt wird. So kann z. B. beim Lesen eines Textes eine metakognitive Erfahrung bewusst werden, weil man Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Textabschnitten empfindet. Oder man bemerkt bei dem Versuch, die Inhalte des gelesenen Textes zusammenzufassen, dass man einen Textabschnitt doch noch nicht verstanden hat und beginnt deshalb von neuem mit der Planung und Ausführung von Aktivitäten, um das Verständnisproblem zu überwinden. Bei aller Unterschiedlichkeit der Auslöser und der metakognitiven Komponenten, die an derartigen Lernprozessen beteiligt sind, lassen sich zwei Merkmale von Lernprozessen hervorheben, bei denen Metakognitionen offenbar eine zentrale Rolle spielen: Zum einen ist das die Reflexion über den eigenen Lernprozess und zum anderen sind es die durch diese Reflexion ausgelösten strategischen Aktivitäten.
Die Reflexion kann dabei sowohl vergangenheitsbezogen als auch gegenwartsbezogen sein: vergangenheitsbezogen als Nachdenken über Handlungen, gegenwartsbezogen als Nachdenken während des Handelns. Beide Formen der Reflexion sind gleichermaßen Ursprung wie Folge von Metakognitionen. So ist etwa das Nachdenken über Handlungen gleichzeitig die Folge exekutiver Metakognitionen und der Ursprung metakognitiver Erfahrungen und systemischen Wissens. In ähnlicher Weise zeugt auch die metakognitive Aktivität des Nachdenkens während einer Lernhandlung von metakognitiver Sensitivität und erzeugt gleichzeitig epistemisches Wissen. Die Reflexion ist somit Bindeglied zwischen verschiedenen metakognitiven Kompetenzen einerseits und zwischen Metakognitionen und Lernerfolg bzw. Lernleistung andererseits. Gleichzeitig macht sie den Lernprozess bewusst und sorgt dafür, dass verfügbare Strategien auch tatsächlich genutzt werden. So tragen die metakognitiven Kompetenzen des Lernenden zum effizienten Ablauf von Lernprozessen und damit zum erfolgreichen Lernen bei. Dies wirft die Frage auf, wann und wie solche Strategien als individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens eigentlich erworben werden.
Wie werden Strategien erworben?
Der Erwerb von Strategien ist ein mühsames Geschäft. In den wenigsten Fällen kommt es beiläufig und zufällig zum Strategieerwerb, wie es mit vielen Bausteinen unseres Vorwissens geschieht. Auch einfache biologische Reifungsmechanismen bringen keine kognitiven Strategien hervor. Sie sind bestenfalls geeignet, die Genese basaler strategischer Verhaltensmöglichkeiten zu erklären. Komplexe Lernstrategien werden in der Regel erst ab der Sekundarstufe erworben. Baumert und Köller (1996) berichten, dass sich ein Repertoire differenziert einsetzbarer Lernstrategien überhaupt erst im Alter von 15 bis 16 Jahren ausbildet. Diese Einschätzung gilt sicherlich für komplexe und vor allem metakognitive Lernstrategien. Einzelne Behaltensstrategien werden aber schon von Kindern im Grundschulalter spontan gezeigt. Die Frage, wann Strategien erworben werden, lässt sich nicht leicht beantworten, weil dies in hohem Maße von der Art und Komplexität der Strategien sowie von den instruktionalen Rahmenbedingungen einer Lernsituation abhängig ist.
Dennoch weiß man einiges darüber, wie Strategien überhaupt erworben werden. Besonders gut erforscht ist die Entwicklung basaler Behaltensstrategien im Grundschulalter, z. B. des Wiederholens und Kategorisierens von Informationen. Im ersten Stadium des Strategieerwerbs bringen die Kinder eine Strategie weder spontan hervor, noch sind sie in der Lage, eine durch ein kompetentes Modell demonstrierte Strategie selbst zu übernehmen. Es scheint ihnen an den notwendigen kognitiven Voraussetzungen bzw. an den zur Strategieanwendung notwendigen vermittelnden Vorbedingungen (den sogenannten Mediatoren) zu mangeln. Denn selbst wenn ein kompetentes Modell die in Frage stehende Strategie demonstriert und wenn die Kinder aufgefordert werden, die so demonstrierte Strategie selbst zu nutzen, sind sie dazu nicht in der Lage. Dieses Stadium wird in der Entwicklungspsychologie mit dem Begriff des Mediationsdefizits umschrieben – es ist in der Regel nur bei sehr jungen Kindern anzutreffen.
Anders sieht es bei Kindern aus, die zwar spontan eine bestimmte Strategie nicht einsetzen oder nutzen, aber nach entsprechenden hilfreichen Hinweisen dazu in der Lage sind und dann auch davon profitieren. Sie befinden sich im zweiten Stadium des Strategieerwerbs, dem Stadium des sogenannten Produktionsdefizits. Hier verfügen die Kinder zwar im Prinzip über die zur Umsetzung der Strategie notwendigen Prozeduren bzw. Mediatoren, sie übernehmen eine Strategie aber nicht in ihr spontanes Verhaltensrepertoire. Dass ihnen die Nachahmung der Strategien noch schwerfällt, lässt sich daran beobachten, dass sie eine Strategie wieder aufgeben, sobald sie nicht mehr explizit dazu aufgefordert werden, sie zu nutzen. Vermutlich liegt das Produktionsdefizit darin begründet, dass das Wissen über die Nützlichkeit einer Strategie (als Teil des deklarativen systemischen Metagedächtnisses) noch nicht hinreichend ausgebildet ist (Hasselhorn, 1996). Mit anderen Worten: Die Kinder sind noch nicht hinreichend davon überzeugt, dass sich ein (zunächst aufwendiger) Strategieeinsatz später einmal auszahlen wird.
Miller (1990) hat darauf hingewiesen, dass mit dem Übergang vom Produktionsdefizit zum effektiven Strategiegebrauch in der Regel noch ein weiteres Stadium zu beobachten ist, das mit den Begriffen Nutzungsdefizit (Miller, 1994) bzw. Nutzungsineffizienz (Hasselhorn, 1996) umschrieben wird. In diesem Stadium bringen die Kinder zwar die betreffende Strategie spontan hervor, jedoch wirkt sich die Strategienutzung noch nicht in der zu erwartenden Weise günstig auf die entsprechende Lernleistung aus. Miller und Seier (1994) vermuten, dass diese (vorübergehende) Ineffizienz der Strategienutzung hauptsächlich auf zwei Mechanismen zurückzuführen ist: auf die unzureichende Automatisierung der Strategie und/oder auf die mangelnde Sensitivität dafür, wann und wie die Strategie wirkungsvoll einsetzbar ist. Eine unzureichende Automatisierung der Strategienutzung hat auch zur Konsequenz, dass zu viel Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (s. o.) für die Ausführung der strategischen Prozeduren benötigt wird. Die mangelnde Sensitivität für den wirkungsvollen Einsatz der Strategie zeigt einmal mehr die Bedeutung metakognitiver Kompetenzen für erfolgreiches strategisches Lernen.
Читать дальше