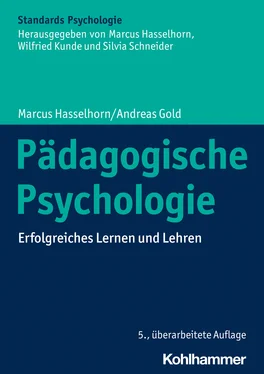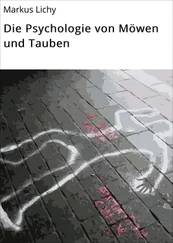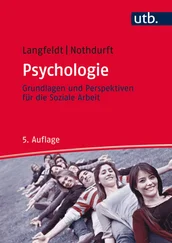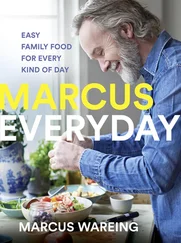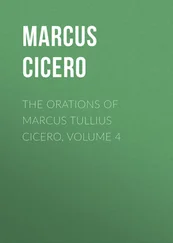Um eine solche Behaltensanforderung möglichst gut zu bewältigen, kann man ganz unterschiedlich vorgehen. Erwachsene setzen in der Regel eine oder mehrere der folgenden Strategien ein: Sie memorieren die Liste, indem sie die gehörten Wörter möglichst mehrmals leise oder lautlos (innerlich) nachsprechen; sie malen sich (innerlich) ein Bild aus oder stellen sich eine Szene bzw. eine Szenenfolge vor, in der die in der Liste vorkommenden Objekte enthalten sind oder sie entdecken die kategoriale Ordnungsmöglichkeit der Liste – nämlich dass darin vier Einrichtungsgegenstände, vier Tiere, vier Fahrzeuge und vier Kleidungsstücke enthalten waren – und organisieren die Begriffe entsprechend beim Einprägen und Wiedergeben der Liste.
Wer die kategoriale Ordnungssystematik beim Lernen einer Liste von Wörtern nutzt, wer beim Durcharbeiten eines Lehrbuches die besonders wichtig erscheinenden Begriffe unterstreicht und für jedes gelesene Kapitel eine kurze Zusammenfassung schreibt, der zeigt strategisches Lernverhalten. Was aber sind eigentlich Strategien?
Eine Strategie besteht aus einer kognitiven Operation oder einer Sequenz unabhängiger kognitiver Operationen, die den zwangsläufig beim Bearbeiten einer Aufgabe stattfindenden Prozessen übergeordnet sind und auf diese zurückgreifen. Strategien dienen kognitiven Zielen (z. B. dem Verstehen oder Behalten) und sind potentiell bewusste und kontrollierbare Aktivitäten. (Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust & Miller, 1985, S. 4)
Die Definition von Pressley et al. (1985) trifft schon die beiden Hauptmerkmale, die in späteren Präzisierungen des Strategiebegriffs als notwendige Bestandteile identifiziert wurden: die Zielgerichtetheit und die Tatsache, dass es sich bei Strategien stets um mehr handeln muss als nur um die obligatorischen Vorgänge und Erfordernisse bei der Bearbeitung von Reizinformationen. Nach einer Sichtung der einschlägigen Literatur konnte Hasselhorn (1996) sechs weitere häufig angeführte Merkmale von Strategien identifizieren: dass Strategien (1) absichtlich, (2) bewusst und (3) spontan eingesetzt werden, dass sie vom Lernenden (4) ausgewählt und (5) kontrolliert werden und dass der Strategieeinsatz (6) Anteile der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses verbraucht.
Nahezu alle diese Bestimmungsmerkmale von Strategien sind bei der Strategienutzung in Lern- oder Behaltenskontexten anzutreffen, sind aber nicht zwingend notwendig. Gegen die Merkmale der Absichtlichkeit und der Bewusstheit lässt sich einwenden, dass Lernende oftmals unbewusst und nahezu intuitiv Strategien hervorbringen, die sich dann als ausgesprochen effektiv erweisen. Führt beispielsweise eine Lehrperson im Mathematikunterricht die Technik des Zerlegens bei der Addition zweistelliger Zahlen ein (41+16 = 41+10+6), so wird sie gelegentlich feststellen, dass einige Schüler diese Technik bereits beherrschen und anwenden, ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne dass sie sich darüber jemals Gedanken gemacht hätten.
Wollte man hingegen nur spontanes strategisches Verhalten als Strategie klassifizieren, so handelte man sich das Folgeproblem ein, dass eine Lerntechnik, die erst aufgrund einer expliziten Aufforderung von den Lernenden gezeigt wird, nicht mehr als Strategie gelten könnte. Das Merkmal der Selektivität impliziert die Auswahl zwischen alternativen Verhaltensoptionen. Da es aber durchaus auch Lernanforderungen gibt, bei denen solche Optionen entweder nicht vorhanden oder nicht sinnvoll sind und in denen eine angemessene Strategieanwendung nur darin besteht, die obligatorischen (und automatisch ablaufenden) Verarbeitungsprozesse einfach zu unterbinden, ist eine Auswahl zwischen alternativen Vorgehensweisen gelegentlich gar nicht notwendig.
Ähnliche Argumente sprechen dafür, dass auch die Merkmale der Kontrolle und der Kapazitätsbelastung nicht notwendigerweise auf strategisches Verhalten zutreffen müssen. So kann z. B. bei sehr vertrauten und oft geübten Strategien auf die Kontrolle verzichtet werden. Und das Merkmal der Kapazitätsbelastung scheint eher auf das Anfangsstadium einer neu erworbenen Strategie zuzutreffen. Je routinierter eine Strategie eingesetzt werden kann, desto weniger Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird durch ihre Ausführung verbraucht werden.
Definition: Lernstrategien
Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind und die über die obligatorischen Vorgänge bei der Bearbeitung einer Lernanforderung hinausgehen. Lernstrategien weisen wenigstens eine zusätzliche Eigenschaft auf, indem sie entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden.
Schon die sehr allgemeine definitorische Umschreibung von Strategien lässt erahnen, dass die Qualität verfügbarer Strategien zu den entscheidenden individuellen Bedingungen erfolgreichen Lernens gehört. Im GIV-Modell von Pressley et al. (1989) steht das strategische Lernverhalten im Zentrum. Um die Vielzahl der bereits untersuchten Lernstrategien zu ordnen, ist es hilfreich, sie weiter zu klassifizieren (was im Übrigen zugleich eine effiziente Verstehensstrategie darstellt, s. u.).
Zu den prominentesten Taxonomien von Lernstrategien gehört die Unterscheidung zwischen kognitiven Strategien, metakognitiven Strategien und Stützstrategien des externen Ressourcenmanagements (Dansereau, 1985; Weinstein & Mayer, 1986). Als externes Ressourcenmanagement bezeichnet man alle Bemühungen zur Optimierung der Lernumwelt, z. B. durch eine angemessene Gestaltung des Arbeits- und Lernplatzes, durch die Nutzung institutioneller Gegebenheiten wie z. B. Sprachlabore, Büchereien oder Computerräume sowie durch die Bildung von Arbeits- bzw. Lerngruppen. Auf diese, das Lernarrangement betreffenden Stützstrategien (man nennt sie auch sekundäre »Studying Strategies« im Unterschied zu den primären »Learning Strategies« der Informationsverarbeitung) gehen wir im Folgenden nicht weiter ein, da wir in diesem Kapitel die internen Bedingungen erfolgreichen Lernens fokussieren. Um hierzu ein möglichst differenziertes Bild zu zeichnen, erläutern wir zunächst, was unter kognitiven Strategien und was unter metakognitiven Strategien zu verstehen ist. Die effektive Nutzung kognitiver und metakognitiver Strategien setzt weitere metakognitive Kompetenzen voraus, die wir in einem dritten Schritt vorstellen. Vor diesem Hintergrund gehen wir anschließend der Frage nach, wie Strategien erworben werden und ob es dispositionelle strategische Präferenzen beim Lernen (Lerntypen bzw. Lernstile) gibt.
Kognitive Strategien werden üblicherweise gemäß ihrer besonderen Funktionen im Lernprozess unterteilt. Die Bezeichnungen fallen dabei eher phänomenologisch aus, indem zwischen Memorier- oder Wiederholungs- sowie Organisations- und Elaborationsstrategien unterschieden wird (z. B. Friedrich & Mandl, 1992). In Anlehnung an Mayer (2003a) bevorzugen wir eine funktionale Beschreibung der unterschiedlichen Kategorien kognitiver Strategien und schlagen vor, von mnemonischen Strategien, strukturierenden Strategien und von generativen Strategien zu sprechen.
Mnemonische Strategien oder Mnemotechniken sind Techniken, die dabei helfen, neue Informationen im Arbeitsgedächtnis zu halten, um eine Verknüpfung mit dem bereits vorhandenen (aber nicht spontan aktivierten) Vorwissen zu unterstützen. Ein typisches Beispiel für eine einfache mnemonische Strategie ist das pure Wiederholen von Informationen, was sich insbesondere beim Auswendiglernen von Fakten als hilfreich erweist. Durch das stetige Wiederholen erfolgt eine leichtere Informationsübertragung in den Langzeitspeicher. Die neuen Informationen werden so zum Bestandteil des (Vor-)Wissens, auf das wir später zurückgreifen können, ohne dafür Arbeitsgedächtniskapazitäten erneut im nennenswerten Umfang zu benötigen. Das Erlernen des kleinen Einmaleins ist hierfür ein gutes Beispiel.
Читать дальше