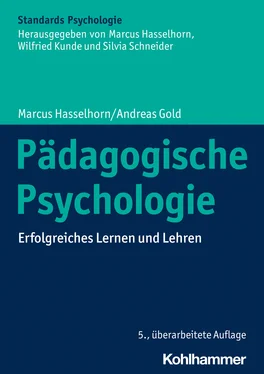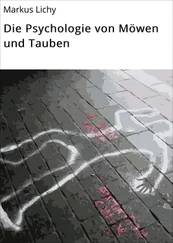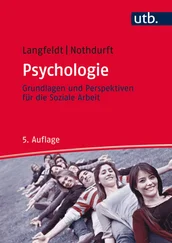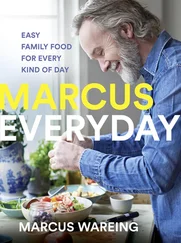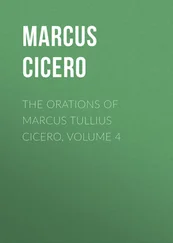Um keine falschen Hoffnungen zu wecken: In den Teilabschnitten dieses Kapitels kann es nicht darum gehen, eine umfassende, für die Optimierung individuellen Lernens geeignete Theorie zu skizzieren. Eine solche Theorie haben wir nicht anzubieten. Denn trotz äußerst fruchtbarer Weiterentwicklungen der pädagogisch-psychologischen Lernforschung, die auch in den nachfolgenden Kapiteln 2 und 3 skizziert werden, gilt noch immer die von Hilgard und Bower vorgenommene Einschätzung:
Die Konstruktion einer völlig zufriedenstellenden Lerntheorie wird wahrscheinlich noch auf lange Zeit eine unvollendete Aufgabe bleiben. (Hilgard & Bower, 1966/1970, S. 29)
• Welches sind die philosophischen und historischen Wurzeln moderner Auffassungen über Lernen?
• Was sind die Grundideen der Auffassung vom Lernen als Verhaltensformung bzw. Verhaltensänderung und welche Lernprinzipien folgen daraus?
• Was sind die Grundideen und Lernprinzipien der Auffassung vom Lernen als Wissenserwerb?
• Welche Vorstellungen stecken hinter dem Ansatz, Lernen als Wissenskonstruktion aufzufassen?
1.1 Lernen als Assoziationsbildung
Mit dem Gedanken, dass sich alle Erkenntnis aus der Erfahrung ableitet, erlangte die in England ansässige philosophische Schule des Empirismus um Thomas Hobbes, John Locke und David Hume im 17. und 18. Jahrhundert Weltgeltung. Im 19. Jahrhundert war es John Stuart Mill, der die Erkenntnislehre des englischen Empirismus wieder in Erinnerung brachte. Unter Rückgriff auf Aristoteles entwickelten die Vertreter des englischen Empirismus die Assoziationstheorie. Erkenntnis basiert dieser Theorie zufolge auf den sinnlichen Erfahrungs- bzw. Vorstellungsassoziationen, deren elementarste Form die räumliche und zeitliche Berührung von Ereignissen (Kontiguität) darstellt, die aber auch durch wahrgenommene Gleichheit oder Ungleichheit (Gesetz der Ähnlichkeit bzw. des Kontrasts) und durch die Wahrnehmung einer zeitlichen Abfolge (Gesetz der Kausalität) zustande kommen können.
Als sich am Ende des 19. Jahrhunderts eine eigenständige physiologisch-naturwissenschaftliche Psychologie zu etablieren begann, wurde zur Beschreibung menschlicher Geistestätigkeiten auf das in der philosophischen Assoziationstheorie formulierte Prinzip der Kontiguität zurückgegriffen:
Wenn zwei elementare Hirnprozesse gleichzeitig oder in unmittelbarer Aufeinanderfolge aktiv gewesen sind, dann kommt es beim Wiederauftreten des einen tendenziell zu einer Erregungsübertragung auf den anderen. (James, 1890, S. 566)
Assoziationen zwischen Reizen und Reaktionsimpulsen
Edward L. Thorndike (1898, 1913a, 1913b) kam aufgrund seiner Lernexperimente mit Katzen zu der Auffassung, dass die Grundlage des Lernens die Verknüpfung bzw. Verbindung (Assoziation) zwischen Sinneseindrücken oder Reizen (engl. Stimuli, S) und Handlungs- oder Reaktionsimpulsen (engl. Responses, R) sei – und nicht nur die assoziative Verbindung zwischen zwei Sinneseindrücken. Durch die Betonung der Handlungsimpulse, aber auch im Bemühen um objektive Verhaltensbeschreibungen wurden Thorndikes tierexperimentelle Lernstudien zu wichtigen Vorläufern des amerikanischen Behaviorismus ( 
Kap. 1.2 1.2 Lernen als Verhaltensänderung Durch gänzlich pragmatische Umsetzungen der assoziationstheoretischen Überlegungen Thorndikes begann in den 1920er Jahren eine neue, verhaltensorientierte (behavioristische) Auffassung des Lernens ihren weltweiten Siegeszug. Als Gründer dieser mit großem pädagogischen Optimismus betriebenen, jedoch dem Wesen nach eher atheoretischen Lernphilosophie gilt John B. Watson. Zu den Kernannahmen der behavioristischen Sichtweise zählen, 1. dass Lernen – wissenschaftlich verstanden – gleichzusetzen ist mit sichtbaren Verhaltensänderungen, 2. dass diese Verhaltensänderungen eine direkte, also nicht durch intrapsychische Zwischenprozesse vermittelte, Funktion der Verknüpfung von Umweltreizen (Stimuli) und Verhaltensweisen (Reaktionen) sind, und 3. dass der Aufbau von Verhaltensweisen in hohem Maße durch das Ausnutzen von Reiz-Reaktions-Kontingenzen beeinflussbar ist (Watson, 1919). Schon früh wurde der behavioristische Verzicht auf Annahmen über die intrapsychischen Zwischenprozesse kritisiert. Dennoch dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis sich Vorläufer der heute dominierenden Auffassungen von Lernen ( Kap. 1.3 und Kap. 1.4 ) durchsetzen konnten. Wesentlich für den lang anhaltenden Erfolg behavioristischer Lernauffassungen waren die vornehmlich tierexperimentellen Arbeiten von Burrhus F. Skinner, der mit großem Geschick pädagogisch leicht umsetzbare Lernprinzipien der Verhaltensformung herausgearbeitet hat. Skinners Werk gilt nicht zuletzt wegen seiner Klarheit und des unmissverständlichen Anspruchs, Lernen als objektiv-beschreibende Verhaltenswissenschaft zu betreiben, als radikal-behavioristisch.
).
Thorndike (1913b, S. 23) zufolge vollzieht sich das menschliche Lernen – genau wie das Lernen von Tieren – als eine Art »assoziativer Mechanismus«, der einigen wenigen Gesetzen folgt. Die drei wichtigsten Lerngesetze in Thorndikes ursprünglicher Theorie sind (1) das Gesetz der Bereitschaft (Law of Readiness), (2) das Gesetz der Übung (Law of Exercise) und (3) das Gesetz des Effekts (Law of Effect).
(1) Das Gesetz der Bereitschaft beschreibt die Bedingungen, unter denen Assoziationen zwischen Sinneseindrücken und Reaktions- bzw. Handlungsimpulsen zu Empfindungen von Lust oder Unlust führen. Thorndike nahm an, dass alle Sinneseindrücke unspezifische Erregungen der beteiligten Nervenzellen zur Folge hätten und dass solche Erregungen an andere, mehr oder weniger aufnahmebereite Neurone weitergeleitet würden. Ein Handlungsimpuls (und damit die Bereitschaft zum Handeln) komme durch die Erregung einer ganzen Kette weiterer Neurone zustande. Die Gesamtheit dieser Kette hat Thorndike als »assoziationsfähige Einheit« bezeichnet.
1. Wenn eine assoziationsfähige Einheit zum Vollzug der Assoziation bereit ist, ist die entsprechende Erregungsleitung befriedigend (lustvoll) und es geschieht nichts, um sie in ihrem Ablauf zu behindern.
2. Kann eine Verknüpfungsbereitschaft nicht realisiert werden, führt dies zu Unlustempfindung und ruft eine naturgegebene Reaktion hervor, um den unbefriedigenden Unlustzustand zu beseitigen.
3. Auch das Erzwingen einer assoziativen Verknüpfung ohne entsprechende Bereitschaft führt zu einer Unlustempfindung. (Thorndike, 1913a, S. 128)
Mit dem Gesetz der Bereitschaft wird den wichtigen motivationalen Randbedingungen der Assoziationsbildung zwischen den Sinneseindrücken und den Handlungsimpulsen Rechnung getragen.
(2) Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes der Übung begründet die Beobachtung, dass sich die einmal gebildeten Assoziationen in ihrer »Stärke« immer wieder verändern können. Die Intensität, mit der ein bestimmter Sinneseindruck einen mit ihm verknüpften Handlungsimpuls hervorruft (und damit die Auftretenswahrscheinlichkeit der entsprechenden Handlung bestimmt), ist also durchaus modifizierbar. Das Gesetz der Übung besagt, dass Assoziationen durch wiederholten Gebrauch gestärkt, durch Nichtgebrauch bzw. Nicht-Fortführung der Übung jedoch geschwächt werden (Vergessen).
(3) Das Gesetz des Effekts gilt als wichtigster Baustein in Thorndikes Theorie. Es bezieht sich auf die Stärkung oder Schwächung von Assoziationen als Folge von Handlungskonsequenzen. Hat ein Sinneseindruck bei einer Person eine assoziationsfähige Einheit für einen Handlungsimpuls erregt, und zwar so stark, dass der Handlungsimpuls tatsächlich in eine Reaktion umgesetzt wurde, und erfährt die Person nun Konsequenzen ihrer Handlung, die sie als befriedigend oder lustvoll (Belohnung) empfindet, so bewirkt dies eine Stärkung der ausgebildeten Assoziation. Löst die nach einer Handlung erfahrene Konsequenz hingegen nicht zufriedenstellende Empfindungen aus, kommt es zu einer Abnahme der Stärke der Assoziation. In seiner ursprünglichen Fassung des Effekt-Gesetzes ging Thorndike noch von einer Wirkungsparallelität von lustvollen und aversiven Empfindungen aus. Später (Thorndike, 1932) hat er diese Annahme revidiert. Die Ergebnisse seiner vornehmlich tierexperimentellen Untersuchungen hatten gezeigt, dass unter sonst gleichen Randbedingungen lustvolle Empfindungen verhaltenswirksamer sind als aversive.
Читать дальше