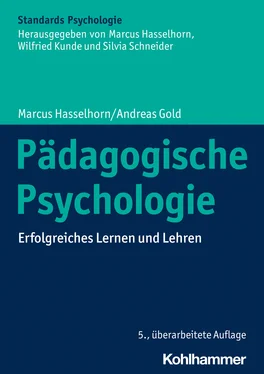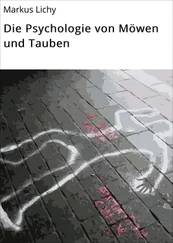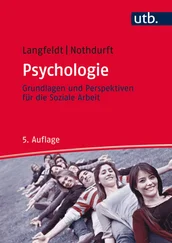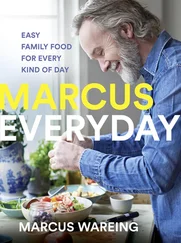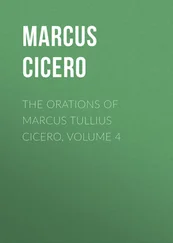Assoziationen zwischen Reizen (klassisches bzw. respondentes Konditionieren)
Das Prinzip der räumlich-zeitlichen Kontiguität zweier Sinneseindrücke wurde auch zum Erklärungsansatz für ein Lernphänomen, das erstmals 1899, also zeitgleich mit Thorndikes frühen Lernexperimenten, in einer von Iwan P. Pawlow betreuten Dissertation beschrieben und später als »konditionierter Reflex« (noch später als »konditionierte Reaktion«) bezeichnet wurde. Der experimentelle Nachweis des Phänomens besteht aus drei Phasen. (1) In der Kontrollphase wird zweierlei überprüft: zum einen, dass ein spezifischer Reiz (ein sogenannter unkonditionierter Stimulus US) tatsächlich eine spezifische Verhaltensweise (eine sogenannte unkonditionierte Reaktion UR) auslöst; zum anderen, dass ein beliebiger neutraler Reiz (ein sogenannter neutraler Stimulus NS) eben diese (unkonditionierte) Reaktion nicht hervorruft. (2) In der eigentlichen Konditionierungsphase kommt es so lange zu einer wiederholten zeitgleich oder zeitlich eng aufeinander folgenden Darbietung des neutralen und des unkonditionierten Reizes, bis die vormals unkonditionierte Reaktion auch durch die Darbietung des vormals neutralen Reizes ausgelöst wird. Um zu überprüfen, ob aus dem vormals neutralen nun tatsächlich ein sogenannter konditionierter Stimulus (CS) geworden ist, wird (3) in der Löschungsphase dieser Reiz wieder alleine dargeboten. Ist die klassische (respondente) Konditionierung gelungen, dann löst er die vormals unkonditionierte Reaktion nun alleine aus. Um zu unterstreichen, dass hierbei Lernen als Verhaltensänderung stattgefunden hat, wird diese nun als konditionierte Reaktion (CR) bezeichnet. Die Stärke der gelernten Verbindung wird allerdings zunehmend geringer, wenn die räumlich-zeitliche Nähe der Reizdarbietungen wieder aufgehoben wird. Die ersten Nachweise solch konditionierter Reaktionen erfolgten am Beispiel des Speichelflusses bei Hunden (Pawlow, 1927).
Pawlow und Mitarbeiter konnten im Labor beobachteten, dass der Anblick von Futter (US) bei einem Hund zur Produktion und Absonderung von Speichel (UR) führte, nicht aber der Ton, der durch das Anschlagen einer Stimmgabel erzeugt wurde (NS). Nach wiederholter Präsentation des Stimmgabeltones unmittelbar vor der Futterdarbietung (Konditionierungsphase) vermochte aber auch der Stimmgabelton (nun zum CS geworden) die Speichelsekretion (nun CR) auszulösen.
Eigentlich geht es beim klassischen Konditionieren darum, eine bereits im Verhaltensrepertoire vorhandene Reaktion auf bestimmte Reize auf einen anderen, neuartigen Reiz zu transferieren. Dies geschieht, indem in systematischer Weise eine neue Assoziation zwischen zwei Reizen (Stimuli) ausgebildet wird, mit dem Ergebnis, dass eine bereits vorhandene Reiz-Reaktions-Verknüpfung auf einen weiteren (Auslöser-)Reiz übertragen wird.
Kontiguität vs. Kontingenz. Lange Zeit glaubte man, dass die räumliche und zeitliche Nähe zwischen den Reizen für die Assoziationsbildung beim klassischen Konditionieren notwendig sei. Besonders radikal ist diese Position von Edwin R. Guthrie (1959) vertreten worden, der alle Lernvorgänge mit der Gleichzeitigkeit (Kontiguität) des ursprünglich neutralen Signalreizes und der bereits vorhandenen Reiz-Reaktionsverbindung zu erklären versuchte. Später hat man allerdings das Phänomen der klassischen Konditionierung auch bei größeren zeitlichen Abständen nachweisen können, ja selbst dann, wenn gar keine Kontiguität zwischen den zwei Reizen bestand (Anderson, 2000; Steiner, 2006). Möglicherweise ist also gar nicht die Kontiguität zweier Reize der entscheidende Wirkmechanismus, sondern es gibt einen anderen Faktor, der ausschlaggebend ist: die Kontingenz zwischen zwei Reizen. Von Kontingenz spricht man, wenn ein Reiz oder ein Ereignis das Auftreten eines zweiten Reizes oder Ereignisses zuverlässig vorhersagt, also signalisiert. Nehmen wir beispielsweise an, zwei Brüder streiten relativ häufig und zwar in allen möglichen Situationen. Bei genauer Beobachtung ließe sich aber feststellen, dass sie nur sporadisch miteinander streiten, wenn sie miteinander Fußball spielen, dass sie aber fast immer streiten, wenn sie gemeinsam im Fernsehen ein Fußballspiel verfolgen. Obwohl beide Verhaltensweisen (miteinander Fußball spielen und gemeinsam ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgen) also zusammen mit dem Ereignis »Streit« auftreten (Kontiguität), besteht eine Kontingenz lediglich für die assoziative Verbindung »gemeinsam ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgen« und nachfolgend »gibt es Streit«. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Brüder streiten werden, ist also beim Verfolgen eines Fußballspiels im Fernsehen bedeutsam größer als bei anderen gemeinsamen Aktivitäten, wie z. B. dem gemeinsamen Fußballspielen.
Rescorla (1988) vertritt eine mit modernen kognitiven Lerntheorien gut vereinbare Interpretation des respondenten Konditionierens, der zufolge nicht die Kontiguität von Reizen, sondern die Kontingenzinformation, die der konditionierte über den unkonditionierten Reiz enthält, von entscheidender Bedeutung sei. Diese Erklärung geht davon aus, dass nicht das gemeinsame Auftreten von konditionierten und unkonditionierten Stimuli entscheidend ist, sondern das Ausmaß und die Zuverlässigkeit, mit der der konditionierte das Auftreten des unkonditionierten Stimulus vorhersagt. Entscheidend ist also der Informationsgehalt, den ein Reiz über einen anderen Reiz liefert und weniger das räumliche und zeitliche Zusammentreffen der beiden Reize.
Konnektionismus. Das Interesse an der auf Thorndike und Pawlow zurückführbaren Grundauffassung des Lernens als Assoziationsbildung hat zu Beginn der 1950er Jahre merklich nachgelassen. Dies hat zweifelsohne mit dem damaligen weltweiten Siegeszug der Auffassung von Lernen als Verhaltensformung ( 
Kap. 1.2 1.2 Lernen als Verhaltensänderung Durch gänzlich pragmatische Umsetzungen der assoziationstheoretischen Überlegungen Thorndikes begann in den 1920er Jahren eine neue, verhaltensorientierte (behavioristische) Auffassung des Lernens ihren weltweiten Siegeszug. Als Gründer dieser mit großem pädagogischen Optimismus betriebenen, jedoch dem Wesen nach eher atheoretischen Lernphilosophie gilt John B. Watson. Zu den Kernannahmen der behavioristischen Sichtweise zählen, 1. dass Lernen – wissenschaftlich verstanden – gleichzusetzen ist mit sichtbaren Verhaltensänderungen, 2. dass diese Verhaltensänderungen eine direkte, also nicht durch intrapsychische Zwischenprozesse vermittelte, Funktion der Verknüpfung von Umweltreizen (Stimuli) und Verhaltensweisen (Reaktionen) sind, und 3. dass der Aufbau von Verhaltensweisen in hohem Maße durch das Ausnutzen von Reiz-Reaktions-Kontingenzen beeinflussbar ist (Watson, 1919). Schon früh wurde der behavioristische Verzicht auf Annahmen über die intrapsychischen Zwischenprozesse kritisiert. Dennoch dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis sich Vorläufer der heute dominierenden Auffassungen von Lernen ( Kap. 1.3 und Kap. 1.4 ) durchsetzen konnten. Wesentlich für den lang anhaltenden Erfolg behavioristischer Lernauffassungen waren die vornehmlich tierexperimentellen Arbeiten von Burrhus F. Skinner, der mit großem Geschick pädagogisch leicht umsetzbare Lernprinzipien der Verhaltensformung herausgearbeitet hat. Skinners Werk gilt nicht zuletzt wegen seiner Klarheit und des unmissverständlichen Anspruchs, Lernen als objektiv-beschreibende Verhaltenswissenschaft zu betreiben, als radikal-behavioristisch.
) zu tun. Als jedoch in den 1980er Jahren Lernen zunehmend als ein paralleles Verarbeiten von Informationen aufgefasst wurde, das über verschiedene neuronale Einheiten hinweg verteilt stattfindet, kam es zu einer Renaissance des »Konnektionismus«, wie Thorndike selbst seine Assoziationsgesetze genannt hatte. In sogenannten PDP-Modellen (Parallel Distributed Processing) simulierte man Lernen auf der Basis komplexer neuronaler Strukturen, wobei die bekannten Regeln der Assoziationsbildung als grundlegende Prinzipien der Informationsübertragung von Neuron zu Neuron herangezogen wurden. Wie Anderson (2000) sehr pointiert zusammenfasst, haben sich die konnektionistischen Modelle tatsächlich als geeignet erwiesen, um die vornehmlich kortikal lokalisierbaren höheren Lernprozesse abzubilden. Allerdings sind die meisten menschlichen Lernvorgänge zusätzlich mit einer Aktivierung subkortikaler Strukturen des limbischen Systems – vor allem des sogenannten Hippocampus – verbunden (  Abb. 1.1). Solche Prozesse werden aber in den konnektionistischen Ansätzen nicht modelliert.
Abb. 1.1). Solche Prozesse werden aber in den konnektionistischen Ansätzen nicht modelliert.
Читать дальше