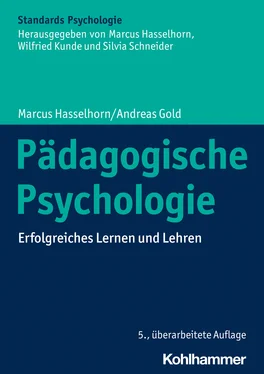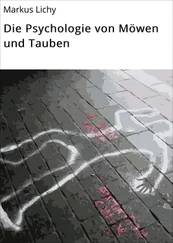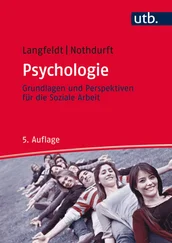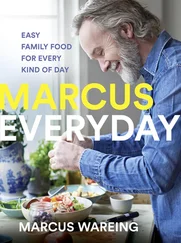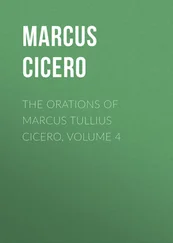Marcus Hasselhorn - Pädagogische Psychologie
Здесь есть возможность читать онлайн «Marcus Hasselhorn - Pädagogische Psychologie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Pädagogische Psychologie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pädagogische Psychologie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Pädagogische Psychologie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Für die vorliegende 5. Auflage wurde das Werk umfassend überarbeitet. Aufgrund der ungebremsten Entwicklungsdynamik der Forschung im Bereich der Pädagogischen Psychologie des Lernens und Lehrens und in den entsprechenden Teilbereichen der Empirischen Bildungsforschung waren erhebliche Aktualisierungen und Ergänzungen vorzunehmen. Beibehalten wurde jedoch die grundlegende Struktur, also eine Aufteilung in die beiden Hauptteile «Lernen» und «Lehren».
Pädagogische Psychologie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Pädagogische Psychologie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Teil I dieses Lehrbuchs besteht aus vier Kapiteln:
1. Auffassungen über Lernen
2. Erfolgreiches Lernen als gute Informationsverarbeitung
3. Ergebnisse erfolgreichen Lernens
4. Besonderheiten des Lernens
In Kapitel 1 werden die einflussreichsten Antworten auf die Frage »Was ist Lernen?« nachgezeichnet. Trotz weitgehender Übereinstimmung, dass Lernen immer etwas mit der Veränderung von Verhalten oder von Verhaltensmöglichkeiten zu tun hat, wird zu zeigen sein, dass diese Frage sehr unterschiedlich beantwortet werden kann. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob wir uns für die direkt beobachtbaren Verhaltensänderungen oder aber für die nicht direkt beobachtbaren Veränderungen »im Kopf« von Lernenden interessieren und ob wir uns eher an den Inhalten oder an den Prozessen des Lernens, eher an den Gemeinsamkeiten oder eher an den Unterschieden zwischen Lernenden orientieren. In unserer Darstellung wird den nicht direkt beobachtbaren Veränderungen »im Kopf« der Lernenden und den Prozessen des Lernens unter Berücksichtigung interindividueller Unterschiede besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Sie sind für die Gestaltung und Optimierung des institutionellen Lernens in Schul- und Bildungssystemen von entscheidender Bedeutung.
Kapitel 2 kann als Schlüsselkapitel für die von uns vertretene Sichtweise des Lernens aufgefasst werden. Hier wird Lernen aus der Perspektive einer »guten Informationsverarbeitung« (Pressley, Borkowski & Schneider, 1989) beschrieben. Gute Informationsverarbeitung beruht auf einer Reihe individueller Voraussetzungen. Die wichtigsten dieser Voraussetzungen haben wir in einem Modell der INdividuellen VOraussetzungen erfolgreichen Lernens (kurz: INVO-Modell) beschrieben. Das INVO-Modell orientiert sich am erfolgreichen individuellen Lernen und fokussiert die dazu beitragenden individuellen Voraussetzungen. Es ist ein idealer Orientierungsrahmen zur Beschreibung, Erklärung und Optimierung von Lernprozessen.
Mit den Lernergebnissen, also den Konsequenzen und dem Nutzen eines erfolgreichen Lernens für den einzelnen Lernenden, beschäftigt sich Kapitel 3. Dabei wird herausgearbeitet, dass die Grundlagen und Ziele erfolgreichen Lernens, nämlich der Erwerb basaler Fertigkeiten und bereichsspezifischer Expertise sowie der Aufbau inhaltsübergreifender Kompetenzen, in systematischer Weise mit den Prinzipien guter Informationsverarbeitung zusammenhängen.
Das erreichbare Ausmaß erfolgreichen Lernens hängt von individuellen Besonderheiten der Begabungen und vom erreichten Entwicklungsstand ab. Mit einigen allgemeinen Entwicklungsvoraussetzungen und individuellen Lernbesonderheiten beschäftigt sich abschließend das Kapitel 4 dieses ersten Teils.
1 Auffassungen über Lernen
Die Einleitung zum ersten Teil dieses Lehrbuchs haben wir mit der Feststellung begonnen, dass die Lernfähigkeit ein wichtiges Wesensmerkmal des Menschen ist. Die Lernfähigkeit erlaubt es, regelhaft und adaptiv auf aktuelle, sich stetig ändernde Anforderungen und Umweltereignisse zu reagieren. Dieses besondere Potenzial ist angeboren (übrigens auch bei den meisten nicht-menschlichen Lebewesen), nicht jedoch das Ausmaß seiner Nutzung. Zwar lernen alle Menschen, aber nicht alle können ihre Lernpotenziale in der gleichen Weise nutzen. Individuelles Lernen ist also die Nutzung des angeborenen, durch biologische Reifungsprozesse sich erweiternden, aber auch durch die Nutzung von Lerngelegenheiten sich stetig weiter entwickelnden Lernpotenzials. Eine gänzliche Nichtnutzung des individuellen Lernpotenzials ist schlichtweg undenkbar. Deshalb findet Lernen im Leben jedes Menschen statt, auch wenn es häufig unbewusst und beiläufig (inzidentell) und seltener gezielt und absichtlich (intentional) erfolgt.
Menschen müssen lernen. Die Phänomene, die uns als Beispiele von Lernen in den Sinn kommen, sind äußerst vielfältig. Sie reichen vom Auswendiglernen eines Gedichts, dem Aneignen neuer Vokabeln, dem Erwerb spezieller Kenntnisse und Fertigkeiten zur Nutzung des Internets oder zur Bedienung eines Fahrkartenautomaten über die Herausbildung von Vorlieben und Abneigungen oder die Übernahme von Vorurteilen bis hin zur Verfestigung individueller Angewohnheiten und Besonderheiten, wie z. B. einem ständigen Räuspern. Allein die Aufzählung dieser Beispiele macht deutlich, wie unterschiedlich Lernen sein kann: Lernen kann absichtlich (Vokabeln lernen) oder beiläufig (Entstehen von Vorlieben) vor sich gehen; es kann durch intensives Üben und Wiederholen (Gedicht lernen) oder durch eine einmalige Beobachtung (wie man einen Zapfhahn an einer Tankstelle benutzt) zustande kommen; es kann als Bereicherung und als Zugewinn (ein Computerprogramm für Videokonferenzen beherrschen) oder als Verschlechterung (sich lästige Angewohnheiten aneignen) empfunden werden.
Doch was ist den mit diesen Phänomenen verbundenen Lernprozessen gemeinsam? Was ist Lernen? Was genau ist geschehen, wenn wir sagen, dass jemand etwas gelernt hat? Hier stehen wir vor einer der Kernfragen der Psychologie. Bei der Beschäftigung mit dieser Frage haben sich unterschiedliche Auffassungen darüber gebildet, was zum Auslösen von Lernprozessen führt bzw. welchen Gesetzmäßigkeiten Lernen unterliegt. Trotz dieser unterschiedlichen Auffassungen, von denen die wichtigsten in diesem Kapitel skizziert werden, lässt sich auf einer sehr allgemeinen Ebene eine gemeinsame Vorstellung, d. h. ein definitorischer Kern von Lernen identifizieren.
Definition: Lernen
Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt.
Lernen ist der Prozess, in dessen Folge es zu einer Änderung eines Verhaltenspotenzials kommt. Von einem Potenzial und nicht vom Verhalten selbst wird gesprochen, weil sich das Produkt des Lernens (das Lernergebnis) nicht notwendigerweise unmittelbar in einem konkret beobachtbaren Verhalten niederschlagen muss (obwohl ein solcher Niederschlag zur leichten Feststellung des sichtbaren Lernerfolgs sehr hilfreich ist). Dass gelernt wurde, kann sich auch in zukünftigen Handlungen oder Verhaltensweisen noch zeigen. Der Prozess des Lernens unterscheidet sich von anderen Veränderungsprozessen (wie z. B. Reifungs- oder Degenerationsvorgängen) wesentlich dadurch, dass er unmittelbar an Erfahrungen gebunden ist.
Uneinheitlich sind allerdings die Auffassungen darüber, was genau diesen Lernprozess ausmacht, was genau eine überdauernde Änderung von Verhaltenspotenzialen – also das Produkt oder Ergebnis des Lernprozesses – charakterisiert und welche Art von Erfahrungen geeignet sind, den Lernprozess auszulösen.
Ungeachtet der durchaus kontroversen Sichtweisen zu diesen Fragen ist der vorangestellten Definition des Lernens aber zu entnehmen, dass Lernen nicht denkbar ist ohne eine besondere Instanz, in der die Ergebnisse von Lernprozessen konserviert werden – also einem Gedächtnis. Obwohl in der Lernforschung zeitweise die Ansicht vertreten wurde, dass Lernen auch ohne Gedächtnis funktionieren könne (so z. B. von John B. Watson, dem Begründer der behavioristischen Lerntheorie), sind sich Lernforscher spätestens seit der sogenannten Kognitiven Wende darin einig, dass jeder Lernprozess auch von einer mentalen Veränderung begleitet wird, die in irgendeiner Form das Lernergebnis konserviert und dauerhaft sichert.
So weit zu den Gemeinsamkeiten psychologischer Vorstellungen darüber, was Lernen ist. In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels sollen nun die wichtigsten und bis heute einflussreichen Auffassungen über Lernen dargestellt werden. Unsere Auswahl ist dabei notwendigerweise selektiv. Das ist schon allein aus Gründen der Darstellungsökonomie erforderlich. Bereits in den 1960er Jahren benötigten Hilgard und Bower (1966) für einen kompakten Überblick damals diskutierter Theorien des Lernens ein zweibändiges Werk, und seither sind eine Vielzahl neuer Erkenntnisse hinzugekommen (z. B. Anderson, 2000; Baddeley, 1998). Auf eine detaillierte Darstellung einzelner Lerntheorien wird deshalb völlig verzichtet. Stattdessen wird ein übergeordnetes Kategorienschema (Auffassungen über Lernen) gewählt, um zu beschreiben, welche Aspekte von Lerntheorien unter der Perspektive einer Nutzung in pädagogischen Situationen von besonderer Bedeutung sind. Vier grundlegende Auffassungen über Lernen werden dabei unterschieden: erstens, dass Lernen durch die Bildung von Assoziationen zwischen Sinneseindrücken und Handlungsimpulsen oder zwischen Reizinformationen zustande komme ( 
Kap. 1.1 1.1 Lernen als Assoziationsbildung Mit dem Gedanken, dass sich alle Erkenntnis aus der Erfahrung ableitet, erlangte die in England ansässige philosophische Schule des Empirismus um Thomas Hobbes, John Locke und David Hume im 17. und 18. Jahrhundert Weltgeltung. Im 19. Jahrhundert war es John Stuart Mill, der die Erkenntnislehre des englischen Empirismus wieder in Erinnerung brachte. Unter Rückgriff auf Aristoteles entwickelten die Vertreter des englischen Empirismus die Assoziationstheorie. Erkenntnis basiert dieser Theorie zufolge auf den sinnlichen Erfahrungs- bzw. Vorstellungsassoziationen, deren elementarste Form die räumliche und zeitliche Berührung von Ereignissen (Kontiguität) darstellt, die aber auch durch wahrgenommene Gleichheit oder Ungleichheit (Gesetz der Ähnlichkeit bzw. des Kontrasts) und durch die Wahrnehmung einer zeitlichen Abfolge (Gesetz der Kausalität) zustande kommen können. Als sich am Ende des 19. Jahrhunderts eine eigenständige physiologisch-naturwissenschaftliche Psychologie zu etablieren begann, wurde zur Beschreibung menschlicher Geistestätigkeiten auf das in der philosophischen Assoziationstheorie formulierte Prinzip der Kontiguität zurückgegriffen: Wenn zwei elementare Hirnprozesse gleichzeitig oder in unmittelbarer Aufeinanderfolge aktiv gewesen sind, dann kommt es beim Wiederauftreten des einen tendenziell zu einer Erregungsübertragung auf den anderen. (James, 1890, S. 566)
); zweitens, dass Lernen im Wesentlichen als Verhaltensänderung auf der Basis der operanten Konditionierungsgesetze zu beschreiben sei ( 
Kap. 1.2 1.2 Lernen als Verhaltensänderung Durch gänzlich pragmatische Umsetzungen der assoziationstheoretischen Überlegungen Thorndikes begann in den 1920er Jahren eine neue, verhaltensorientierte (behavioristische) Auffassung des Lernens ihren weltweiten Siegeszug. Als Gründer dieser mit großem pädagogischen Optimismus betriebenen, jedoch dem Wesen nach eher atheoretischen Lernphilosophie gilt John B. Watson. Zu den Kernannahmen der behavioristischen Sichtweise zählen, 1. dass Lernen – wissenschaftlich verstanden – gleichzusetzen ist mit sichtbaren Verhaltensänderungen, 2. dass diese Verhaltensänderungen eine direkte, also nicht durch intrapsychische Zwischenprozesse vermittelte, Funktion der Verknüpfung von Umweltreizen (Stimuli) und Verhaltensweisen (Reaktionen) sind, und 3. dass der Aufbau von Verhaltensweisen in hohem Maße durch das Ausnutzen von Reiz-Reaktions-Kontingenzen beeinflussbar ist (Watson, 1919). Schon früh wurde der behavioristische Verzicht auf Annahmen über die intrapsychischen Zwischenprozesse kritisiert. Dennoch dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis sich Vorläufer der heute dominierenden Auffassungen von Lernen ( Kap. 1.3 und Kap. 1.4 ) durchsetzen konnten. Wesentlich für den lang anhaltenden Erfolg behavioristischer Lernauffassungen waren die vornehmlich tierexperimentellen Arbeiten von Burrhus F. Skinner, der mit großem Geschick pädagogisch leicht umsetzbare Lernprinzipien der Verhaltensformung herausgearbeitet hat. Skinners Werk gilt nicht zuletzt wegen seiner Klarheit und des unmissverständlichen Anspruchs, Lernen als objektiv-beschreibende Verhaltenswissenschaft zu betreiben, als radikal-behavioristisch.
); drittens, dass Lernen im Wesentlichen als Erwerb deklarativen, prozeduralen und konditionalen Wissens als Folge mentaler Verarbeitungsprozesse im menschlichen Informationsverarbeitungssystem charakterisierbar sei (  Kap. 1.3); und viertens, dass sich Lernen am besten als eine individuelle Konstruktion von Wissen infolge des Entdeckens, Transformierens und Interpretierens komplexer Informationen durch den Lernenden selbst beschreiben lasse (
Kap. 1.3); und viertens, dass sich Lernen am besten als eine individuelle Konstruktion von Wissen infolge des Entdeckens, Transformierens und Interpretierens komplexer Informationen durch den Lernenden selbst beschreiben lasse (  Kap. 1.4).
Kap. 1.4).
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Pädagogische Psychologie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Pädagogische Psychologie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Pädagogische Psychologie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.