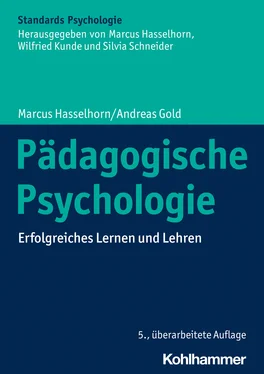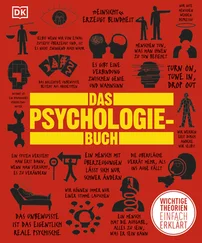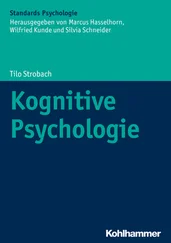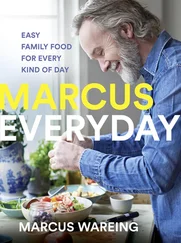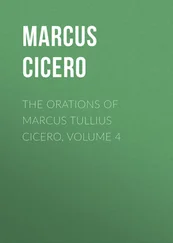Ferster und Skinner (1957) haben die Langzeitwirkungen von ungefähr 20 unterschiedlichen Vorgehensweisen der systematischen intermittierenden Verstärkung im Tierversuch untersucht. In der Pädagogischen Psychologie des menschlichen Lernens sind vier Grundtypen dieser Vorgehensweisen – man bezeichnet sie auch als Verstärkungspläne – besonders verbreitet (Steiner, 2006). Sie lassen sich einem Vier-Felder-Schema zuordnen, je nachdem ob die intermittierende Applikation des Verstärkers an der verstrichenen Zeit oder an der Anzahl der bereits gezeigten erwünschten Verhaltensweisen ausgerichtet wird und ob sie in einem fixierten oder in einem variablen Rhythmus erfolgt.

Rhythmus der Verstärkung
Beziehen sich die Verstärkungen auf die Anzahl der bereits gezeigten erwünschten Verhaltensweisen, so spricht man von einem Quotenplan. Wird regelmäßig im Sinne einer festgelegten Quote (z. B. jedes fünfte Mal nach dem Auftreten der erwünschten Verhaltensweise) verstärkt, liegt ein Festquotenplan vor; wird dagegen unregelmäßig, aber durchschnittlich jedes fünfte Mal nach dem Auftreten des erwünschten Zielverhaltens verstärkt, spricht man von einem variablen Quotenplan.
Entsprechend ist die Bezugsgröße für die Verstärkerapplikation bei den Intervallplänen die insgesamt verstrichene Zeit. Wird ein Verstärker z. B. regelmäßig auf die erste erwünschte Verhaltensreaktion in einem festgelegten 10-Minuten-Takt gegeben, handelt es sich um einen Festintervallplan. Wird dagegen der Takt der Zeitintervalle für die Verstärkung unterschiedlich gewählt (einmal wird nach fünf Minuten, einmal nach zehn Minuten, einmal nach 15 Minuten verstärkt) und nur im Durchschnitt der 10-Minuten-Takt eingehalten, dann liegt ein variabler Intervallplan vor. Insgesamt gelten die variablen Verstärkungspläne als besonders geeignet, da sie im Allgemeinen eine vergleichsweise höhere Frequenz der erwünschten Verhaltensreaktionen hervorrufen.
Beispiel: Variable Verstärkungspläne
Variable Quotenpläne findet man häufig im Schulalltag – z. B. wenn es um die Belohnung der freiwilligen Mitarbeit im Unterricht geht. Stellen Sie sich vor, in einer Klasse heben immer die gleichen 15 Kinder die Hand, wenn die Klassenlehrerin eine Frage stellt. Gelingt es der Lehrerin, keines der Kinder bevorzugt zu behandeln, dann beträgt für jedes Kind die Wahrscheinlichkeit des Aufgerufenwerdens (Verstärkung) 1:15. Geht die Lehrerin nun aber nicht alphabetisch oder in einer anderen Weise systematisch vor, dann wird die Wahrscheinlichkeit und damit die Auftretenshäufigkeit des Antwortgebens für ein beliebiges Kind in der einen Schulstunde vielleicht bei 1:5 liegen, in einer anderen bei 1:40, im Durchschnitt jedoch bei 1:15. Die Bekräftigung (Aufgerufenwerden) des Zielverhaltens (Mitarbeit) erfolgt hierbei nach der Logik eines variablen Quotenplanes und dürfte ziemlich »löschungsresistent« (s. u.) sein.
Und das Bestrafen? Ein pädagogisch ebenso zentrales wie kontrovers diskutiertes Thema ist die Frage der Wirksamkeit und der Auswirkungen von Strafe. Aus der Sicht der behavioristischen Lernpsychologie interessiert dabei vornehmlich die vergleichende Verhaltenswirksamkeit der Darbietung eines aversiven Reizes (z. B. Tadel oder Strafarbeit) oder des Entzugs eines angenehmen Reizes (z. B. Taschengeld einbehalten oder Fernsehverbot) in Folge eines unerwünschten Verhaltens. In Skinners frühen Arbeiten finden sich einige experimentelle Befunde hierzu. Deren unzulässige Übergeneralisierung hat häufig zu der Fehleinschätzung geführt, dass Bestrafungen grundsätzlich nicht geeignet seien, überdauernde Verhaltensänderungen hervorzurufen. Durch Strafe – so wurde kolportiert – ließe sich ein unerwünschtes Verhalten nur unterdrücken, nicht aber verändern, so dass es nach Absetzen der Strafe schon bald wieder in fast dem gleichen Maße auftrete wie zuvor. Seit den 1950er Jahren konnte jedoch in zahlreichen Studien nachgewiesen werden, dass Strafe dann ebenso effektiv sein kann wie Verstärkung, wenn sie vom Strafenden nur richtig angewandt und vom Bestraften subjektiv richtig verstanden und verarbeitet wird (Johnston, 1972; Steiner, 2006). Wie muss wirksame Strafe beschaffen sein? Azrin und Holz (1966, S. 426 f) haben darauf die folgenden Antworten gegeben:
1. Der Strafreiz sollte so gesetzt werden, dass ein Ausweichen nicht möglich ist.
2. Er sollte so intensiv wie möglich sein und kontinuierlich erfolgen.
3. Er sollte unmittelbar auf das unerwünschte Verhalten folgen und von Anfang an mit maximaler Intensität angewendet werden.
4. Ausgedehnte Bestrafungsphasen sollten vermieden werden.
5. Es ist darauf zu achten, dass der Strafreiz nicht differenziell mit einer Verstärkung assoziiert wird, damit die Bestrafung keine verstärkenden Eigenschaften erwirbt.
6. Bestrafung kann auch durch Entzug positiver Verstärkungen erreicht werden. Dies setzt allerdings voraus, dass bereits ein gewisses Niveau vorangegangener Verstärkungen erreicht wurde, da sonst ein wirksamer Entzug von Verstärkung nicht möglich ist.
Aus der prinzipiellen Wirksamkeit von Bestrafung folgt jedoch noch nicht, dass sie für den pädagogischen Einsatz besonders geeignet ist. Es besteht nämlich die Gefahr, dass Strafen unerwünschte Nebeneffekte nach sich ziehen. So kann Strafe Abneigung oder Angst gegenüber dem Strafenden hervorrufen und unerwünschtes Flucht- bzw. Vermeidungsverhalten oder gar Aggressionen auslösen. Smith und Smoll (1997) konnten beispielsweise zeigen, dass Kinder, die im Mannschaftssport während eines Spiels von ihrem Trainer permanent kritisiert wurden, in der Regel eine ablehnende Einstellung zu der ausgeübten Sportart entwickelten. Nicht selten führt dies zu Vermeidungsverhalten (»Ich höre mit dem Fußballspielen ganz auf!«).
Es gibt weitere unerwünschte Nebeneffekte, wie etwa das Auftreten psychosomatischer Beschwerden oder die Entwicklung und Verfestigung einer negativen Selbstwahrnehmung. Strafendes Verhalten von Lehrern und Erziehern kann zu einem »erfolgreichen« Modell aggressiven Verhaltens werden, das zur unerwünschten Nachahmung anstiftet (Strassberg, Dodge, Pettit & Bates, 1994; Straus & Kantor, 1994). Schließlich kann es zur Ausbildung einer »erlernten Hilflosigkeit« kommen, wenn nämlich ein alternatives Verhalten gar nicht möglich ist, durch das man dem Strafimpuls entgehen könnte.
Fokus: Erlernte Hilflosigkeit
Das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit (Learned Helplessness) wurde erstmals in einem Tierexperiment von Seligman und Maier (1967) illustriert. Zu Beginn des Experimentes wurden einige Hunde in einem Netz festgehalten und schmerzhaften Stromstößen (elektrischen Schocks) ausgesetzt. Die Hälfte der Hunde ließ man aus dieser Pein entkommen, wenn sie eine entsprechende mechanische Vorrichtung betätigten. Die andere Hälfte bekam keine Möglichkeit zu fliehen.
Am nächsten Tag wurden die beiden Gruppen sowie eine dritte Gruppe, die am Vortag nicht mit Stromstößen gepeinigt worden war, einem Schockvermeidungstraining in einem Doppelkäfig unterzogen. Dort lernten sie, auf einen schrillen Ton hin (diskriminativer Hinweisreiz) über die Trennwand hinweg in den jeweils anderen Käfigteil zu fliehen, was den Ton zum Verschwinden brachte und den drohenden Stromstoß fernhielt, da die elektrischen Schocks nur in der einen Käfighälfte appliziert wurden. Die Hunde, die am Vortag durch eigenes Fluchtverhalten die Schocks hatten beenden können, lernten das Vermeidungsverhalten so schnell wie die bislang nicht geschockten Tiere der dritten Gruppe. Dagegen waren die Hunde, die in der ersten Versuchsphase unvermeidbare Stromstöße erhalten hatten, regelrecht hilflos: Nur selten sprangen sie in den geschützten Käfigteil hinüber; stattdessen kauerten sie still, ließen die Stromstöße über sich ergehen und winselten. Die Erfahrung mit nicht-kontingenten, unvermeidbaren und intensiven Strafreizen hatte sie offenkundig hilflos gemacht.
Читать дальше