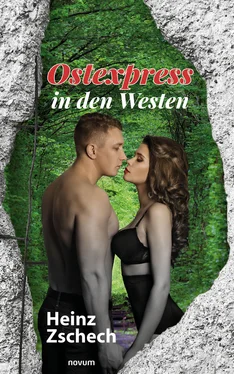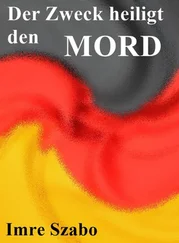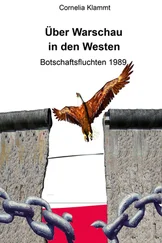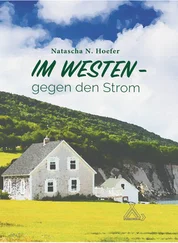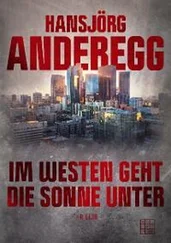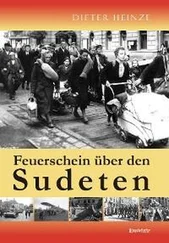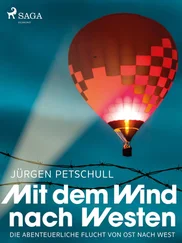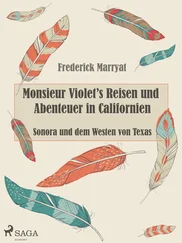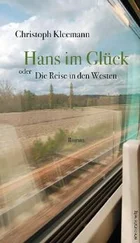„Und die Musik?“ – „Die Kapelle mit Pauken und Posaunen! Und dahinter die Frauen in den sorbischen Trachten.“
„Keine Musik!“
„Haut auf die Pauke!“
„So. Fröhlich das Herz! – Die Hochzeitsbitter links und rechts von dem Ganzen! Nach außen! Die Flasche ist nicht zu sehen! – Klick!“
„Jeder auf seine Plätze!“ —
Vorn marschiert die Musik, alsdann kommen die Bitter, die „Damen“, die Herren, die Kühe, die Pferde, die Engel, die Teufel – zu aller guter Letzt Krabat in seiner alten wackligen Kutsche. „Das den keiner nach hinten überholt! Man wüsste sonst nicht, wer uns fehlt.“ – „Eins, zwei, drei – einen Marsch!“
„Wir fangen beim Bürgermeister an und danach geht’s linksherum weiter.“ Die Blasmusik paukt, das Schifferklavier klirrt, die Teufelsgeige krächzt und die Engel fliegen dreimal über das Dorf. In seinem dicken Strafregister blättert der Advokat: „Herr Bürgermeister schönen Tag!“ – Alle sind aus dem Häuschen, die Trompeten zwitschern ein Ständchen und die Hochzeitsbitter bitten zum Tanz. Den wendischen Frauen wirbeln die roten, grünen oder himmelblauen Röcke, und im Takt drehen die Schleifen die Runde. Schnaps verschenkt sich wie Freude, man schüttelt sich, lacht, wischt an den Lippen. In die Liste tragen die Bitter die Namen: „Wie viel wolltest du gleich geben?“
„20 Mark.“ – Es wird notiert und bedankt und ins nächste Haus eingezogen: „Schönen Gruß!“ – Die anderen besetzen den freigewordenen Platz. Die Kuh spritzt ihr Bier in die Eimer, die Soldaten drohen mit Krieg, der Schornsteinfeger jagt Kinder und verschmiert seinen Ruß an den hübschen weißen Mädchengesichtern: „Man hätte sich auch loskaufen können.“ –
Auf dem Hof demonstriert das Brautpaar die Liebe, und die Beglückte zeigt stolz das Falsche von ihr. Der Engel aber sammelt brav Eier für seine verlorenen ein, und allen hängt eine Büchse am Hals: „In den Schlitz bitte werfen das Geld.“ – Genau um die Hälfte betrügt die Zigeunerin ihre Klienten. Sie hatte es aber ihnen schon vorher geweissagt.
Auf jedem Hof singt die Musik, jauchzen die Stimmen, rollt das Geld in die Büchsen verhext, und der Feuerwehrmann löscht mit dem Wasser die hitzigen Köpfe. Der Polizist indessen schreibt die Strafzettel aus. Der Zug rattert durchs Dorf, und die Kinder verfolgen ihn ängstlich mit Abstand: „Ist das ein Fest!“ – Der Bär tanzt mit der Tschertschick eine Runde für Speck, der Fliegenspritzer schüttet tote Fliegen aufs Haupt, und die Ziegen lecken die Stiefel. Jedem Haus gilt die Offerte, jedes Haus ist zu einem offenen, öffentlichen erklärt, und die Lust biegt sich vor Freude den Buckel. – An dreien der Häuser aber baumelt ein Schloss, und man sagt: „Das sind Zeugen Jehovas. Für die ist das Zampern vom Teufel, wie auch die Wahl, die Gemeindeversammlung, das Erntedankfest im Herbst.“ – Die Hexe macht drei Kreuze ans Tor, und der Feuerwehrmann wirft einen Knallfrosch über den Zaun, dann torkelt man weiter zu den offenen Türen. Die Kutsche aber mit den vier lahmen Pferden in ihrem Geschirre fährt auf, und die Peitsche schlägt gegen das Tor. Erschreckt weicht das Holz, der Wagen rollt auf den Hof, und Krabat, witzig gewitzt, erzählt seine Geschichte. Die Kinder klammern sich vor Schreck an die scheckigen sorbischen Trachtenröcke, die Frauen kichern in ihre Tücher, und die Alten blicken mit zwinkerndem Auge misstrauisch hinter den Schwank: „Das ist doch Sarodnicks Jüngster!“
12
Hinter vorgehaltener Tür hat Tretin dem Ältestenrat des Kurses etwas zu sagen. Inständig lange drängt ihn der Professor, dass er noch einmal auf gut Freund melde, was er unlängst ihm selbst bereits angezeigt hatte: Das Verhalten Sarodnicks ist nicht kursgerecht, wäre sowjetfeindlich gar. Tretin aber hält hinter dem Berg, lauscht bloß dem kurzfliegenden Atmen seines Professors.
„Bitte, Jakob, wiederhole, was du mir und dem Rektor mitgeteilt hast.“ Tretin erhebt sich, fühlt plötzlich Schwäche in seiner schmalen Brust, lässt sich jedoch nicht von den rosshaarigen Beinen holen. Mit gesenkten Lidern kaut er genüsslich jedes Wort auf der Zunge:
„Ja. Sowjetfeindlich!“ – Ratlos muckt sich das Kollektiv: „Wir verstehen das nicht.“
„Na schon raus mit der Sprache!“, drückt der Professor kraftvoll auf die Tube, und unehrenvoll tropft es von den auftragenden Lippen Tretins zu Boden:
„Sarodnick macht oft Bemerkungen … zum Beispiel über die Tschechoslowakei, über Dubček, über die Panzer …“ – Jakob sucht die Blicke seines Beschützers: Kuleschow kann ihn doch jetzt nicht alleine hier zappeln lassen!
Zu Hause würde er ihm jetzt einen Fisch braten, bis er blau wär. Zu Hause! Ist nicht Lew schließlich und endlich sein Vater, „wie ein Vater“, „an Vaters statt“ – ein versprochener Vater nun doch?
Kuleschow hatte mit Tretins Vater einst mal Freundschaft geschlossen – hinter verschlossenen Türen – und hatte sich hinter dessen Rücken geschickt versteckt in den Jahren der „Der Großen Zeit“, der wechselnden Ämter, des „Heute-was-und-morgen-Nichts“. Sein Vater war schließlich ein angesehener Maler, „offiziell“, war angesehen, genehmigt, gelobt von der Hohen Stelle im Staat, und daher wohlgesehen von allen, ein liebend gesehener Gast: „Mit dem kann man sich sehen lassen! Der malt nur die festgesessenen Köpfe, solche die nicht wackeln, die keine Miene verraten, die man sich unbedenklich in sein Arbeitszimmer aufhängt.“ – „Der kennt sogar ‚Den‘ persönlich!“, flüsterte man. – „Der ist höher als der!“ – „Das ist eine ‚Persona mit Grata‘!“ – „Wer den kennt, wird nicht mehr verkannt, und dies hieße, sein Süppchen im Sicheren kochen!“
Mit Jakob und dessen Vater hatte Lew Kuleschow häufig an einer Tafel gegessen, aus einem Topfe gegessen, hatte ihm seine Sorgen verborgen und ihm einige Male im Vertrauen gesagt, dass die zwanziger Jahre für ihn endgültig vorüber, über, über Bord wären. Von dem Maler hernach erfuhren die Leute, die mehr waren als Leute, was für ein fortschrittlicher und parteilinienfrommer Mensch Kuleschow geworden ist, dass er keine Projekte mehr hat und nie und nimmermehr davon träume, einen Film fürs Kino zu machen. Sein Freund gab ihm da von hinten und vorne vollkommen recht. Und Recht gab ihm Lew wieder dankend zurück, als der sich von der Ehefrau trennte und sich den gemeinsamen Sohn aneignete wie die öffentliche Meinung Gewalt. Die Mutter wurde nicht für „würdig“ erklärt, musste Moskau mit leeren Händen verlassen und wurde später ins Lager geschickt. Den Sohn hatte der Vater, und er ließ ihn nach seinen eigenen Bildern erziehen.
Als jedoch nachmals eine ganze Epoche ins verwelkende Gras biss und des Malers Gönner ihre Lorbeeren büßten, stürzte der alte Jakob wie eine Laus in eine selbstgezündete Kugel: Er hatte es nicht für möglich gehalten. Wer hätte auch bei ihm noch bestellt? Der Laden war dicht. So aber war er in allen Ehren rechtzeitig verschieden: „Man muss in Würde abtreten mögen!“, bewunderte ihn sein Freund Kuleschow. – Noch kurz bevor Jakobs Vater die Pistole in den staunenden Mund zielte, verfasste er einen Brief an diesen: Er möchte doch um seinen Sohn sehen, kümmern, schützen und fördern. Und der frühe Regisseur schwor es auf dem Staatsbegräbnis des tragischen Mannes. – Die Mutter aber erreichte ihre staatliche Gutmachung erst an ihrer Bahre – Mühlen mahlen nicht wie Maler so schnell.
Die Großmutter nahm sich des Waisen an mit dem Wink von dem Freunde: „Für immer auch mein.“ – Tretin wuchs dem Alten ans Herz – hatte er doch seines – und mit ihm seinen Sohn – im Kriege verloren. Er „bemutterte“ ihn, ließ ihn rufen, prüfte die Arbeiten in der Schule und übergab ihn überdies den alten Erziehern, den alten Lehrern, den alten Genossen: Blieben diese doch ihrem glücklicherweise nicht vorzeitig „entlarvten“ Meister treu bis ans Grab und auch darüber hinaus.
Читать дальше