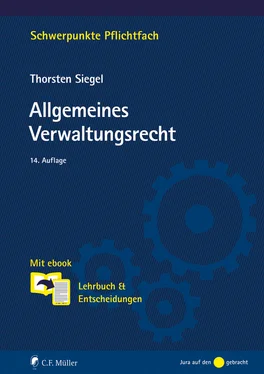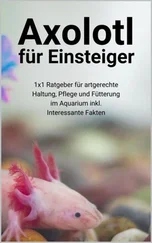502
Das Akteneinsichtsrecht bezieht sich in sachlicher Hinsicht auf alle Akten, welche die Entscheidungsgrundlage der Behörde bilden. Auch in beigezogene Akten anderer Behörden, sonstige Entscheidungsgrundlagen und Daten kann daher Einsicht genommen werden. Erfasst werden auch in elektronischer Form geführte Akten[60]. In zeitlicher Hinsicht wird oftmals eine Beschränkung auf das laufende Verwaltungsverfahrenvorgenommen[61]. Allerdings ermöglicht häufig erst die Akteneinsicht eine Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs. Deshalb sollte das Akteneinsichtsrecht zumindest bis zum Eintritt der Bestandskraft bestehen[62].
503
Die Einsichtnahme in die Aktenerfolgt nach § 29 Abs. 3 regelmäßig bei der aktenführenden Behörde[63]. Bei elektronisch geführten Akten kann die Akteneinsicht durch die Zurverfügungstellung eines Aktenausdrucks, die Wiedergabe elektronischer Dokumente auf dem Bildschirm, die Übermittlung elektronischer Elemente oder den elektronischen Zugriff auf den Akteninhalt erfolgen[64].
504
§ 29 Abs. 2 enthält Ausnahmen vom Akteneinsichtsrecht. Die Ausnahmen sind dem Wortlaut nach sehr weit gefasst. Dies gilt insbes. für die Ausschlussgründe einer Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Behörde oder einer Beeinträchtigung des Wohles des Bundes oder eines Landes. Wegen des verfassungsrechtlichen Fundaments des Akteneinsichtsrechts (s.o. Rn 501) sind sie aber eng auszulegen[65]. Die Vorschrift des § 30, die Geheimhaltung, ist in das Recht auf Akteneinsicht nach § 29 hineinzulesen[66].
gg) Die Durchsetzung von Verfahrensrechten
505
Vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund des Art. 19 Abs. 4 GG sind auch Verfahrensrechte grundsätzlich gerichtlich durchsetzbar. Nach der klassischen Interpretation weist das Verfahren aber gegenüber dem materiellen Recht lediglich eine dienende Funktion auf (s.o. Rn 170). Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber in § 44a S. 1 VwGOgeregelt, dass Verfahrensverstöße grundsätzlich nur im Rahmen eines Angriffs gegen die Sachentscheidung geltend gemacht werden können. Etwas anderes gilt nach § 44a S. 2 VwGO lediglich dann, wenn Verfahrenshandlungen vollstreckt werden können oder gegen einen Nichtbeteiligten ergehen. Im Zuge der zunehmenden Aufwertung des Verfahrensgedankens und der Stärkung der Verfahrensrechte durch das Unionsrecht ist aber auch hier eine einschränkende Auslegung des § 44a S. 1 VwGO geboten[67].
f) Anhang: Nicht-akzessorische Informationsrechte
506
Das Akteneinsichtsrecht nach § 29 (s.o. Rn 501 ff) ist in ein herkömmliches Verwaltungsverfahren eingebettet. Es bildet einen Annex zur Effektivierung der Verfahrensrechte und kann daher als „akzessorisches“ Informationsrecht bezeichnet werden. Zunehmend haben sich allerdings im Laufe der Zeit nicht-akzessorische Verfahrensrechte herausgebildet, bei denen die Erlangung von Informationen den Hauptzweck des Verfahrens bildet[68]. Der Konzeption nicht-akzessorischer Informationsansprüche folgen vor allem die modernen Informationsgesetze[69] wie das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes[70], das Umweltinformationsgesetz[71] und das Verbraucherinformationsgesetz[72]. Hinzu kommen Ansprüche auf Landesebene[73]. Die Ansprüche nach den Umweltinformationsgesetzen bestehen neben etwaigen Ansprüchen nach dem Verbraucherinformationsgesetz[74]; sie gehen jedoch den Ansprüchen nach den allgemeinen Informationsfreiheitsgesetzen vor[75].
507
Diese neuen Gesetze machen die Entscheidung über die Freigabe der Information oftmals zum Verwaltungsakt und etablieren damit ein eigenes auf Information gerichtetes Verwaltungsverfahren[76]. In solchen Verfahren werden Akteneinsicht und Geheimnisschutz von reinen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen zum eigentlichen Verfahrensinhalt[77]. Da diese selbstständigen Informationsansprüche regelmäßig nicht die Darlegung eines rechtlichen Interesses erfordern[78], verlagert sich die Diskussion naturgemäß auf die Reichweite der Ausschluss- und Einschränkungsgründe[79]. Gegenstand jüngerer gerichtlicher Entscheidungen waren etwa die Ausschlussgründe der öffentlichen Sicherheit nach § 3 Nr. 2 IFG[80], gesellschaftsrechtlich begründeter Vertraulichkeitspflichten nach § 3 Nr. 4 IFG[81], des unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands nach § 7 Abs. 2 S. 1 IFG[82] sowie des aufsichtsrechtlichen Geheimnisses der Finanzbehörden[83]. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs kann hingegen nur in besonderen Ausnahmekonstellationen zum Tragen kommen[84]. Schließlich wirft die Begrenzung der Ansprüche auf die Verwaltungstätigkeit immer wieder die Abgrenzungsfrage zur Legislative[85] und zur Judikative[86] auf.
g) Beteiligung der anerkannten Umweltvereinigungen
508
Von stetig zunehmender Bedeutung ist die Beteiligung der anerkannten Umweltvereinigungen. Diese sind keine Betroffenen i.S.d. § 13 (s.o. Rn 487), da sie sich nicht auf eigenerechtliche Interessen berufen können. Auch können sie nicht der Behördenbeteiligung zugerechnet werden, da nicht ihnen, sondern den zuständigen Umweltbehörden die Hauptverantwortung für den betreffenden Umweltbelang zugewiesen wird. Vielmehr handelt es sich um eine Beteiligungsart sui generis, die eigenen Gesetzmäßigkeiten und folglich auch gesonderten gesetzlichen Bestimmungen unterliegt. Im Ausgangspunkt richtet sich die Beteiligung der anerkannten Umweltvereinigungen nach § 63 BNatSchG, wird jedoch durch eine Vielzahl fachrechtlicher Bestimmungen überlagert und ergänzt[87]. Die rechtliche Stellung der anerkannten Umweltvereinigungen ist erheblich durch das Unionsrecht gestärkt worden: Hier folgt aus der völkerrechtlichen Aarhus-Konvention (s.o. Rn 84) und den diese umsetzenden EU-Richtlinien ein Gebot effektiver Verfahrensbeteiligung. Damit standen nach Ansicht des EuGH die zuvor strengen Präklusionsregelungen des innerstaatlichen Rechts nicht in Einklang[88]. Im Anschluss an diese Entscheidung wurden in den von der Entscheidung betroffenen Fachgesetzen die vormals materiellen Präklusionsreglungen durch formelle ersetzt[89].
3. Die Einhaltung von Formvorschriften
a) Grundsatz der Formfreiheit
509
§ 37 Abs. 2–5 regelt die Art und Weise des Erlasses von VAen und daran geknüpfte Rechtsfolgen. Abs. 2 S. 1 stellt heraus, dass ein VA schriftlich, mündlich, elektronisch oder in anderer Weiseerlassen werden kann. Die Norm geht für den Erlass von VAen von Formenfreiheit aus. Das Tatbestandsmerkmal „in anderer Weise“ erlaubt den konkludenten Erlass eines VA, also durch Zeichen.
Beispiele:
Die Aufforderung eines Polizeibeamten, zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an den Straßenrand zu fahren; jedes Verkehrszeichen.
Bei einem schriftlichen oder elektronischen VA muss zudem nach § 37 Abs. 3 S. 1 die den VA erlassende Behörde erkennbarsein. Ausreichend ist es jedoch, wenn sich die Behörde durch Auslegung ermitteln lässt[90].
b) Spezialgesetzliche Formvorgaben
510
§ 37 Abs. 2 S. 1 lässt wegen des in § 1 normierten Subsidiaritätsgrundsatzes Rechtsvorschriften für den Erlass eines VA unberührt, die eine bestimmte Form, zB Schriftformoder Urkunde, zwingend vorschreiben. Solche Formvorschriften sind nach wie vor verbreitet, s. zB § 69 Abs. 2 S. 1; § 10 Abs. 7 BImSchG; § 10 BBG(Ernennungsurkunde des Beamten). Landesrecht schreibt ebenfalls häufig die Schriftform vor. Lange Zeit bedurfte insbes. die Baugenehmigung noch der Schriftform[91]. Allerdings befindet sich das Schriftformerfordernis für die Baugenehmigung wegen der zunehmenden Verbreitung elektronischer Kommunikationsformen zunehmend auf dem Rückzug[92]. Auch soweit die Schriftform angeordnet ist, kann sie nach Maßgabe des § 3a Abs. 2 durch die dort aufgeführten elektronischen Formen ersetztwerden[93]. Eine einfache E-Mail genügt indessen nicht dem Schriftformerfordernis.
Читать дальше