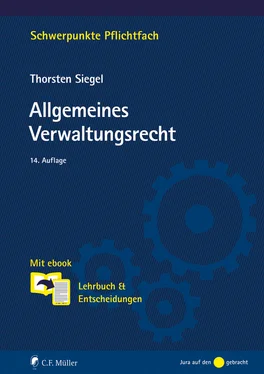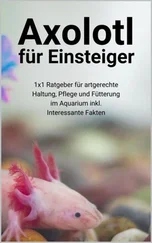Beispiele:
Bebauungsplan als Satzung, § 10 BauGB; Promotionsordnung für den Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin.
I. Einzelne Rechtsquellen
65
Folgende Arten von Rechtsquellen werden unterschieden: Verfassungsgesetze, formelle Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften, Gewohnheitsrecht, Richterrecht, allgemeine Grundsätze des Verwaltungsrechts, Europäisches Unionsrecht und Völkerrecht.
66
Zu den Rechtsquellen auch des Verwaltungsrechts gehört zunächst das Verfassungsrecht. So enthält das Grundgesetz wichtige verfassungsrechtliche Weichenstellungen für die Einteilung in Bundes- und Landesverwaltungsowie den Vollzug von Bundesgesetzen(dazu ausf. § 5 III.). Darüber hinaus gibt das Grundgesetz zentrale Handlungsmaßstäbefür die öffentliche Verwaltung vor. Zu diesen zählen neben der Grundrechtsbindung das Übermaßverbot sowie der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (dazu ausf. § 7).
67
Die bedeutsamsten Rechtsquellen für das Handeln der Verwaltung bilden heute formelle Gesetze, also die Rechtsnormen, die vom Bundestag oder von einem Landesparlament im von der Verfassung vorgeschriebenen Verfahren verabschiedet werden[3]. Viele Normen, die im Sa. I oder in einer das Landesrecht enthaltenden Gesetzessammlung abgedruckt sind, sind Gesetze in diesem Sinne. Zwei Arten von formellen Gesetzen sind zu unterscheiden: Gesetze im nur formellen Sinn und Gesetze im formellen und materiellen Sinn. Gesetze im nur formellen Sinn werden vom Gesetzgeber im förmlichen Gesetzgebungsverfahren beschlossen, normieren aber für den Bürger weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten. Zu diesem Typ von Gesetz zählen die Zustimmung zu bestimmten völkerrechtlichen Verträgen nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG oder die Feststellung des Haushaltsplans nach Art. 110 Abs. 1 GG[4]. Gesetze im materiellen Sinneenthalten demgegenüber abstrakt-generelle Verhaltensnormen für andere Rechtssubjekte. „Generell“ bedeutet, dass sich die Rechtsnorm an eine unbestimmte Vielzahl von Personen richtet; „abstrakt“ meint, dass die Rechtsnorm eine unbestimmte Vielzahl von Sachverhalten regelt.
Beispiel:
Alle Normen des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs; § 1 BAföG(Sa. I Nr 420): „Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.“ Demnach hat jeder (= generell), der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, einen Anspruch auf Ausbildungsförderung für eine dem Gesetz entsprechende Ausbildung (= abstrakt).
68
Rechtsverordnungen sind Rechtsnormen(also abstrakt-generelle Rechtssätze), die von der Exekutive im Wege delegierter Rechtsetzung erlassen werden[5]. Da sie nicht vom parlamentarischen Gesetzgeber erlassen werden, handelt es sich nicht um Gesetze im formellen Sinne. Andererseits erzeugen Rechtsverordnungen als Gesetze im materiellen Sinne Rechte und Pflichten im Bürger-Staat-Verhältnis. Der tiefere Grund für eine solche Übertragung der Rechtsetzungsbefugnis auf die Exekutive liegt darin, dass diese technisch-fachliche Detailfragen oftmals besser einschätzen kann und dadurch zugleich der Gesetzgeber entlastet wird. Besonders deutlich wird dies an der Straßenverkehrsverordnung, die neben der Ausgestaltung detaillierter Verkehrsregeln auch Vorgaben zur Gestaltung der einzelnen Verkehrsschilder enthält. Rechtsverordnungen bilden einerseits eine bedeutsame Rechtsquelle des Verwaltungsrechts; sie gehören andererseits aber auch zu den Handlungsformen der öffentlichen Verwaltung(dazu ausf. § 20).
69
Für die universitäre Ausbildungvon Bedeutung sind – allerdings im Rahmen des Besonderen Verwaltungsrechts – zunächst Rechtsverordnungen zur Gefahrenabwehr im Polizei- und Ordnungsrechts. Ein Beispielbilden etwa Verordnungen mit einem Verbot des Konsums alkoholischer Getränke an bestimmten Stellen[6]. Darüber hinaus enthält die Baunutzungsverordnung im öffentlichen Baurecht Angaben zum Charakter der verschiedenen Baugebiete und zur Zulässigkeit von Bauvorhaben in diesen Gebieten[7].
70
Nach der klassischen Gewaltenteilung werden Rechtsnormen von der Legislative erlassen. Der Erlass einer Rechtsnorm durch die Exekutive ist daher eine Besonderheit und bedarf deshalb gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG bzw. den entsprechenden Bestimmungen der Landesverfassungen[8] einer gesetzlichen Ermächtigungdurch das Parlament. Das Parlamentsgesetz muss zudem Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die Verordnung muss die Rechtsgrundlage, auf Grund derer sie erlassen wurde, angeben. Nach Art. 80 Abs. 2 GG ist unter bestimmten Voraussetzungen die Zustimmung des Bundesrats zum Erlass einer Rechtsverordnung notwendig[9].
71
Satzungen sind Rechtsnormen(also abstrakt-generelle Rechtssätze), die von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten erlassen werden. Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zählen insbes. Gemeinden, die im Rahmen der Vorlesung zum Kommunalrecht behandelt werden (zum Begriff ausf. Rn 139ff). Die Gemeinsamkeit mit Rechtsverordnungen liegt darin, dass auch Satzungen nicht vom parlamentarischen Gesetzgeber erlassen werden und dass es sich damit nicht im Gesetze im formellen Sinne handelt. Der zentrale Unterschied zu Rechtsverordnungenist darin zu sehen, dass bei Satzungen die Rechtsetzungsbefugnis nicht gesondert delegiert wird, sondern bereits in der Berechtigung zur Selbstverwaltung enthalten ist. So haben etwa im Bereich des Kommunalrechts die Gemeinden das Recht, ihre Angelegenheiten durch Satzung zu regeln[10]. Regelmäßig handelt es sich bei Satzungen um Gesetze im materiellen Sinne. Denn sie legen Rechte und Pflichten zwischen dem Satzungsgeber und den Satzungsunterworfenen fest, wie etwa eine kommunale Satzung zur Nutzung des gemeindlichen Schwimmbads. Eine Ausnahme davon bildet die Haushaltssatzung. Denn sie erzeugt keine Außenwirkung und ist daher auch kein Gesetz im materiellen Sinne[11]. Satzungen gehören einerseits zu den Rechtsquellen des Verwaltungsrechts; andererseits bilden sie auch eine bedeutsame Handlungsform der öffentlichen Verwaltung(dazu ausf. § 21).
72
Das Recht zum Erlass von Satzungengestattet den juristischen Personen des öffentlichen Rechts teilweise bereits das Verfassungsrecht: So beinhaltet die Garantie kommunaler Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG auch das Recht der Gemeinden, ihre Angelegenheiten durch Satzung zu regeln[12]. Zumeist wird die Satzungsautonomie aber durch einfaches Gesetz eingeräumt. So erlaubt § 55 Abs. 1 der Handwerksordnung (HwO), dass die Handwerksinnungen ihre Verwaltung und die Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder durch Satzung regeln[13]. Die Einschränkung des Art. 80 Abs. 1 GG (von ihm war zuvor mit Blick auf die Rechtsverordnungen die Rede) gilt für Satzungen nicht.
5. Verwaltungsvorschriften
73
Verwaltungsvorschriften sind Regelungen, die innerhalb der Verwaltungsorganisation von übergeordneten Verwaltungsinstanzen oder Vorgesetzten an nachgeordnete Behörden oder Bedienstete ergehen[14]. Sie dienen dazu, Organisation und Handeln der Verwaltung näher festzulegen. Sie unterscheiden sich jedoch von den bislang vorgestellten Rechtsquellen in wesentlicher Hinsicht: Sie regeln nicht das Verhältnis des Bürgers zum Staat, sondern ihre Wirkung ist auf den Innenbereich der Verwaltung beschränkt. Verwaltungsvorschriften sind freilich mehr als „Nicht-Recht“. Sie spielen eine bedeutsame Rolle im Rahmen des Problems der Selbstbindung der Verwaltung: Diese darf nicht grundlos von einer durch die Beachtung von Verwaltungsvorschriften erzeugten Übung abweichen (zu dieser sog. mittelbaren Außenwirkung s.u. Rn 867). Verwaltungsvorschriften können jedoch aus sachlichen Gründen jederzeit geändert werden[15].
Читать дальше