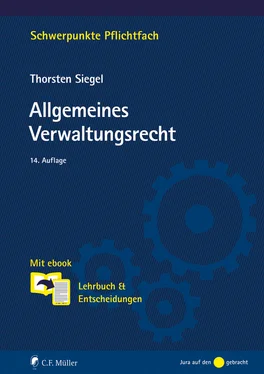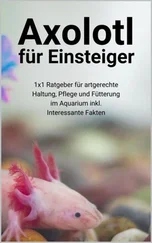42
Einen letzten klausurrelevanten Problembereich bilden Hausverbote. Sie dienen der Wahrung des Hausrechts und können sowohl auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als auch auf dem Gebiet des Privatrechts ausgesprochen werden (vgl. §§ 859 f, 903, 1004 BGB). Die Rechtsprechung unterscheidet grds. nach dem Zweck des Besuchs. Ist der Zweck öffentlich-rechtlich zu qualifizieren (zB Verlängerung des Personalausweises), dann folgt das Hausverbot dieser Rechtsnatur[21]. Die überwiegende Literatur hingegen stellt auf den Zweck des Hausverbots ab. Es sei öffentlich-rechtlich, wenn und weil es dazu dient, die Erfüllung öffentlicher Zwecke im Hause zu sichern[22]. Die letztere Ansicht verdient den Vorzug, da die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs regelmäßig das zentrale Motiv eines Hausverbots bildet und subjektive Motive des Besuchers oftmals nicht überprüfbar sind. Auch in der Rechtsprechung häufen sich inzwischen Entscheidungen, die auf den Zweck der Erfüllung öffentlichen Aufgaben abstellen[23]. Im praktischen Regelfall ist ein solches Hausverbot damit dem öffentlichen Recht zuzuordnen[24].
5. Sonderfall: Die Zwei-Stufen-Theorie
43
Grundsätzlich muss eine Handlung, ein Rechtsverhältnis oder eine Rechtsstreitigkeit entweder dem öffentlichen Recht oder dem Privatrecht zugeordnet werden. Die gleichzeitige Zuordnung zu beiden Rechtsordnungen scheidet also aus. Sind sowohl privatrechtliche als auch öffentlich-rechtliche Elemente vorhanden, so muss in solchen „Gemengelagen“mittels der Abgrenzungstheorien eine Zuordnung erfolgen (s.o. Rn 31ff). In bestimmten Konstellationen können allerdings zwei Entscheidungsstufen aufeinanderfolgen. Die damit umschriebene Zwei-Stufen-Theorie ist ursprünglich für die Vergabe von Subventionen entwickelt worden, zu denen etwa ein zinsgünstiges Darlehen gehört[25]. Darüber hinaus kommt die Zwei-Stufen-Theorie auch bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen nach dem Kommunalrecht zur Anwendung; zu diesen zählen etwa gemeindliche Schwimmbäder oder Bibliotheken[26]. Bei der Zwei-Stufen-Theorie wird auf der ersten Stufe über das „Ob“ entschieden, also darüber, ob eine Subvention vergeben oder der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung gewährt wird. Diese erste Stufe ist dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Die zweite Stufe hat demgegenüber das „Wie“ zum Gegenstand: Auf dieser Stufe werden etwa die Auszahlungs- oder Rückzahlungsmodalitäten einer Subvention geregelt oder die Verhaltenspflichten bei der Nutzung einer öffentlichen Einrichtung. Diese zweite Stufe kann entweder dem öffentlichen Recht oder dem Wahlrecht zuzuordnen sein. Die Zwei-Stufen-Theorie wird ausführlicher im Abschnitt über das privatrechtliche Handeln der Verwaltung dargestellt (s.u. § 23 II.).
44
Lösung zu Fall 1 ( Rn 26):
Nach der Interessentheorie ist entscheidend, welchem Interesse die im Rechtssatz ausgesprochene Regelung dient. Das Verbot, Spraydosen zu verkaufen, dient sowohl dem Interesse privater Hauseigentümer am Schutz ihres Eigentums als auch dem öffentlichen Interesse am Schutz der im Eigentum der öffentlichen Hand befindlichen Sachen. Nach dieser Theorie ist eine Zuordnung nicht möglich. – Nach der Subordinationstheorie kommt es für die Annahme öffentlichen Rechts auf das Vorliegen eines Über-Unterordnungsverhältnisses an. Nach dem Verkaufsgesetz ist es den Geschäften verboten, an „Normalbürger“ Spraydosen zu verkaufen. Dieses Gesetz vollzieht die Gewerbeaufsicht. Zwischen dem einzelnen Verkäufer und der Gewerbeaufsicht besteht ein Über-Unterordnungsverhältnis, weil die Gewerbeaufsicht die Einhaltung des Verkaufsverbots überwacht und Verstöße gegen das Gesetz unterbinden darf. Nach der Subordinationstheorie liegt öffentliches Recht vor. – Nach der modifizierten Subjektstheorie ist entscheidend, ob die Norm einen Träger öffentlicher Gewalt als solchen berechtigt oder verpflichtet. Das Verkaufsgesetz berechtigt und verpflichtet die Gewerbeaufsicht als solche; sie muss die Einhaltung des Gesetzes überwachen und Verstöße gegen es unterbinden. Auch nach der modifizierten Subjektstheorie ist das Verkaufsgesetz öffentliches Recht.
45
Lösung zu Fall 2 ( Rn 27):
Das Problem, ob das durch einen Behördenleiter ausgesprochene Hausverbot gegen einen störenden Besucher seines Verwaltungsgebäudes öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich zu qualifizieren ist, ist seit langem in Streit. Nach lange überwiegender Ansicht in der Rechtsprechung ist auf den Zweck des Besuchs abzustellen. Ist der Zweck öffentlich-rechtlich zu qualifizieren (zB Verlängerung des Personalausweises), dann folgt das Hausverbot dieser Rechtsnatur. Nach inzwischen überwiegender Ansicht ist demgegenüber der Zweck des Hausverbots maßgebend. Es ist öffentlich-rechtlich, wenn und weil es dazu dient, die Erfüllung öffentlicher Zwecke im Hause zu sichern (s.o. Rn 43). In Fall 2 kämen beide Ansichten zu einer Zuordnung zum öffentlichen Recht. Denn sowohl der Zweck des Besuchs (die Korrektur des Personalausweises), als auch der Zweck des Hausverbots (die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs) sind dem öffentlichen Recht zuzuordnen.
III. Verhältnis des Verwaltungsrechts zu den anderen Ebenen des öffentlichen Rechts
1. Verhältnis zum Verfassungsrecht
46
Ein zentrales Problem der Darstellung des Verwaltungsrechts liegt darin, dass – anders als im Privatrecht – oftmals praktische Berührungspunkte der Studierenden fehlen. Zudem erweist es sich – anders als das Strafrecht – als oftmals weniger medienintensiv. Allerdings werden wichtige Elemente des Verwaltungsrechts bereits in der vorausgehenden Vorlesung zum Verfassungsrecht eingeführt[27].
a) Organisatorische und verfahrensbezogene Weichenstellungen
47
So ergibt sich die Unterscheidung zwischen Bundes- und Landesverwaltungbereits aus Art. 30 und 83 ff GG. Das Gleiche gilt für die unterschiedlichen Arten des Vollzugs von Bundesgesetzen, die ebenfalls in Art. 83 ff GG geregelt sind[28]. Aus der grundgesetzlichen Verteilung der Verwaltungskompetenzen zwischen Bund und Ländern in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip ist zudem ein grundsätzliches Verbot der Mischverwaltungabzuleiten (dazu Rn 156)[29].
b) Inhaltliche Entscheidungsmaßstäbe
48
Neben den zuvor skizzierten primär verfahrensbezogenen Regelungen gibt das Grundgesetz aber auch viele inhaltliche Handlungsmaßstäbe für die Verwaltung vor: So statuiert Art. 1 Abs. 3 GG explizit die Grundrechtsbindungauch der öffentlichen Verwaltung. Diese muss daher den Grundrechten auch bei der Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts Rechnung tragen. Darüber hinaus setzt der im Rechtsstaatsprinzip verankerte Verhältnismäßigkeitsgrundsatzim Bereich der Eingriffsverwaltung (s.o. Rn 20) Grenzen[30]. Zudem werden aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltungin Art. 20 Abs. 3 GG der Vorrang sowie der Vorbehalt des Gesetzes abgeleitet. Ersterer besagt, dass die Verwaltung nicht gegen vorhandene Gesetze handeln darf, Zweiterer, dass sie – zumindest in bestimmten Konstellationen – nicht ohne ein entsprechendes Gesetz handeln darf[31]. Da diese verfassungsrechtlichen Handlungsgrundsätze von ausgesprochen großer Bedeutung für die Tätigkeit der Verwaltung sind, werden sie an späterer Stelle ausführlich behandelt (s.u. § 7). Die Grundsätze verdeutlichen jedoch in ihrer Gesamtheit, dass das Verwaltungsrecht eng mit dem höherrangigen Verfassungsrecht verwoben ist. Zu Recht wird daher das Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht bezeichnet[32].
2. Verhältnis zum Europarecht
Читать дальше