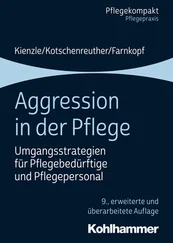2.3 Innovationen im Rahmen von Marktwirtschaft
Innovationen müssen also nicht zwangsläufig im Interesse der in der Praxis tätigen Pflegekräfte liegen. Sie sollen allerdings, so wird man hier einwenden, auch nicht primär deren Bedürfnissen dienen, sondern jenen der Pflegebedürftigen, die man gerne im Rahmen eines marktwirtschaftlich funktionierenden Systems als Kunden und Kundinnen ansieht. Pflege als Dienstleistung wäre demnach ein Produkt wie viele andere auch, das deshalb nachgefragt wird, weil es die bestimmten Bedürfnisse befriedigt. Es lässt sich allerdings die Frage stellen, ob Innovationen im Rahmen der Marktwirtschaft wirklich den Interessen der potenziellen Zielgruppe dienen oder nicht vielmehr den Interessen von Unternehmen, denen es darum geht, ihre Gewinne zu steigern, indem sie neue Absatzmärkte erschließen. Dies sollte man zum Beispiel bei der Einführung digitaler Technologien im Krankenhaus bedenken, von denen der Text im Kasten (  Kasten 2.1) eine durchaus denk- und realisierbare Möglichkeit beschreibt.
Kasten 2.1) eine durchaus denk- und realisierbare Möglichkeit beschreibt.
Kasten 2.1: Mehr Patientensicherheit durch die Digitalisierung der Pflege
Mit der Einführung eines neuartigen, halbautomatisierten Pflegeplanungssystems wird das Personal von aufwendiger Schreibarbeit entlastet und hat mehr Zeit für den Patienten. Das Assessment der Pflegebedürftigkeit erfolgt jetzt mit Hilfe einer standardisierten Checkliste, die alle relevanten Pflegeprobleme abdeckt. Es müssen nur noch Items zu einzelnen Beobachtungsdaten angeklickt werden und das Programm erkennt automatisch, welche Pflegeprobleme vorhanden sind. Die hierzu erforderlichen Cut-Off-Werte sind im System hinterlegt und beruhen auf den neuesten Erkenntnissen der Pflegeforschung. Auch die passenden Pflegemaßnahmen können bei vorhandener Problemfeststellung über ein Drop-Down-Menü abgerufen werden. Ihre Wirksamkeit wurde in pflegewissenschaftlichen Studien getestet. So kann unsere Einrichtung eine evidenz-basierte Standardisierung der Patientenversorgung gewährleisten. Durch regelmäßige Updates des Programms ist sichergestellt, dass stets die neuesten Studienergebnisse in die Planung der Maßnahmen einfließen.
Um auf die individuellen Wünsche unserer Patientinnen und Patienten einzugehen, sind die zentralen Funktionseinheiten unserer Stationen über ein digitales Telekommunikationssystem mit den Patientenzimmern verbunden. Unser akademisch gebildetes Leitungspersonal kann sich so jederzeit bei Bedarf mit den Patientinnen und Patienten in Verbindung setzen und ihre Wünsche erfragen. So können erforderliche Abweichungen von den standardisierten Maßnahmen sofort an die Pflegefachassistenz weitergegeben werden, die für die Durchführung der Pflegemaßnahmen verantwortlich ist. Das Telekommunikationssystem erlaubt darüber hinaus das Erkennen von potenziellen Pflegeproblemen durch das akademisch gebildete Pflegepersonal und die Kontrolle der von der Pflegefachassistenz durchgeführten Maßnahmen.
Die Antwort auf die Frage, ob die skizzierten Innovationen (  Kasten 2.1) im Interesse der zu behandelnden Kranken sind, ist zweideutig. Auf der einen Seite werden unnötige Schreibarbeiten abgebaut, neue Erkenntnisse aus der Forschung den Pflegenden direkt zur Verfügung gestellt und direkte Kontakte zwischen Kranken und hochschulisch gebildetem Pflegepersonal ermöglicht. Auf der anderen Seite erzeugt das evidenz-basierte Pflegeplanungssystem jedoch neue Abhängigkeiten, da es Entscheidungen in Bezug auf die zu wählenden Maßnahmen bereits vorgibt und die regelmäßigen Updates zum neuesten Stand der Evidenz natürlich kostenpflichtig sind. Die digitale Überwachung der Pflegefachassistenz durch hochschulisch gebildete Pflegepersonen verschärft nicht nur die pflegeinterne Hierarchie, sondern ermöglicht es auch, mehr kostengünstige Pflegekräfte einzusetzen. Je höher die Kompetenzstufe der Pflegenden, desto weiter entfernt sind sie vom Bett. Das skizzierte Modell (
Kasten 2.1) im Interesse der zu behandelnden Kranken sind, ist zweideutig. Auf der einen Seite werden unnötige Schreibarbeiten abgebaut, neue Erkenntnisse aus der Forschung den Pflegenden direkt zur Verfügung gestellt und direkte Kontakte zwischen Kranken und hochschulisch gebildetem Pflegepersonal ermöglicht. Auf der anderen Seite erzeugt das evidenz-basierte Pflegeplanungssystem jedoch neue Abhängigkeiten, da es Entscheidungen in Bezug auf die zu wählenden Maßnahmen bereits vorgibt und die regelmäßigen Updates zum neuesten Stand der Evidenz natürlich kostenpflichtig sind. Die digitale Überwachung der Pflegefachassistenz durch hochschulisch gebildete Pflegepersonen verschärft nicht nur die pflegeinterne Hierarchie, sondern ermöglicht es auch, mehr kostengünstige Pflegekräfte einzusetzen. Je höher die Kompetenzstufe der Pflegenden, desto weiter entfernt sind sie vom Bett. Das skizzierte Modell (  Kasten 2.1) ist zwar bis dato noch eine Utopie und die Digitalisierung der Pflege muss auch keineswegs die dort beschriebene Form annehmen (vielmehr sind auch Programme denkbar, die Pflegefachkräfte dabei unterstützen, die Komplexität der Versorgungsprozesse zu erfassen und darzustellen), dennoch stellt sich die Frage, ob Innovationen im Gesundheitswesen den Bedürfnissen der erkrankten Personen dienen oder den ökonomischen Interessen von Unternehmen und Gesundheitsanbietern, die ihre Therapien vermarkten wollen und auf der Suche nach neuen Absatzmärkten sind.
Kasten 2.1) ist zwar bis dato noch eine Utopie und die Digitalisierung der Pflege muss auch keineswegs die dort beschriebene Form annehmen (vielmehr sind auch Programme denkbar, die Pflegefachkräfte dabei unterstützen, die Komplexität der Versorgungsprozesse zu erfassen und darzustellen), dennoch stellt sich die Frage, ob Innovationen im Gesundheitswesen den Bedürfnissen der erkrankten Personen dienen oder den ökonomischen Interessen von Unternehmen und Gesundheitsanbietern, die ihre Therapien vermarkten wollen und auf der Suche nach neuen Absatzmärkten sind.
2.4 Innovation als rationaler Optimierungsprozess
Zunächst einmal gilt: Gesundheit ist ein elementares Bedürfnis von kranken und pflegebedürftigen Personen. Dementsprechend gilt es ihre Behandlung und Betreuung durch Innovationen zu optimieren. Die Rolle, die der Pflege in diesem Zusammenhang zukommt, lässt sich dabei an den Themen und Vorschlägen der Expertenstandards des DNQP ablesen: Vermeidung ungewollter Komplikationen wie Mangelernährung, Sturz oder Dekubitus, Optimierung der Behandlungsabläufe durch Koordination und Schnittstellenmanagement in einem Gesundheitssystem, dessen Fragmentierung zu Versorgungsbrüchen führt, und nicht zuletzt die Förderung der Selbständigkeit der Kranken und Pflegebedürftigen durch Information, Beratung und Schulung, um die Adhärenz an die Therapie sicherzustellen. Dies soll nicht nur die Gesundheit der Betroffenen fördern, sondern auch die Behandlungskosten reduzieren und dadurch den allgemeinen Wohlstand vergrößern. Der Grundsatz »public health is public wealth« erweist an dieser Stelle seine Gültigkeit.
Dabei ist auch eine Orientierung an den Ergebnissen aus Wissenschaft und Forschung vonnöten. Diese liefern nicht nur Innovationen, die dann in der Praxis zur Verbesserung der Versorgung implementiert werden können, sondern auch Nachweise von deren Wirksamkeit. Die Implementierung solcher Innovationen dient also dazu, dass die Patientenversorgung mit Bezugnahme auf externe Evidenz erfolgt. Hierin besteht dem neuen Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) zu Folge vor allem die Rolle hochschulisch gebildeter Pflegekräfte. Wie es dort heißt, sollen diese »forschungsgestütze Problemlösungen wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen« und »wissenschaftsbasiert innovative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und implementieren« können (Bundesministerium für Gesundheit 2017, S. 2593).
Forschung ist mit anderen Worten notwendig, um den Innovationsbedarf der Praxis zu decken, der sich wiederum aus dem Bedarf der Patienten an einer Lösung ihrer Gesundheitsprobleme ergibt.
2.5 Innovation ohne Nachfrage in der Praxis
Die Implementierung von Innovationen in der Pflege durch hochschulisch gebildete Pflegekräfte stellt allerdings nicht nur eine Reaktion auf einen Bedarf an verbesserter Gesundheitsversorgung dar, die Nachfrage nach Forschungsergebnissen wird genauso durch eine Überproduktion an Studien angeschoben. Dem Jahresbericht der International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers zufolge gab es Mitte 2018 etwa 33.100 aktive, wissenschaftlich begutachtete englischsprachige Zeitschriften (plus weitere 9.400 nicht-englischsprachige Zeitschriften), die zusammen über 3 Millionen Artikel pro Jahr veröffentlichten (Johnson et al. 2018). Das ist mehr wissenschaftliche Literatur pro Jahr als eine einzelne Person in ihrem ganzen Leben zu lesen vermag. Auch wenn die pflegewissenschaftliche Literatur nur einen kleinen Teil an der Gesamtheit aller wissenschaftlichen Publikationen ausmacht, so ist doch schon dieser kaum noch überschaubar. Der International Academy of Nursing Editors zufolge gab es 2018 251 englischsprachige, pflegewissenschaftliche Zeitschriften (INANE 2018). Die Menge der jährlich erscheinenden Artikel wird von der Akademie zwar nicht beziffert, dürfte aber so hoch sein, dass eine Gesundheitseinrichtung kaum alle publizierten Resultate mit ihren Verbesserungsvorschlägen zur Kenntnis nehmen, geschweige denn implementieren kann. Die Einführung forschungsgestützter Problemlösungen setzt also deren Auswahl voraus, wofür die Forschungsliteratur allerdings kein Kriterium benennt. Geht es nach den publizierten Studien, scheint jedes Problem in gleicher Weise von Bedeutung zu sein.
Читать дальше
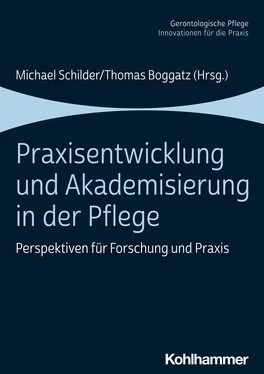
 Kasten 2.1) eine durchaus denk- und realisierbare Möglichkeit beschreibt.
Kasten 2.1) eine durchaus denk- und realisierbare Möglichkeit beschreibt.