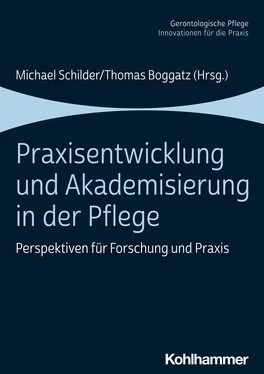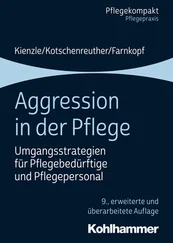Evidenzbasierung, so man sie denn einführen will, erfordert neben der kritischen Bewertung von Studien zudem noch zwei weitere Schritte: Zunächst gilt es, die Relevanz der Studienergebnisse für die Praxis zu bestimmen (welche Konsequenzen können aus der gegenwärtigen und nicht immer überzeugenden Studienlage gezogen werden?) und schließlich geht es um die Implementierung selbst. Erfahrungen aus Großbritannien, wo eine Implementierung von Innovationen schon seit mehr als 30 Jahren betrieben wird, legen dabei nahe, dass ein linearer Top-down-Approach, bei dem auf Anweisung des Managements nach einer Schulung eine neue Maßnahme durch das Personal einfach angewendet werden soll, wenig erfolgsversprechend ist (Shaw 2013). Implementierungsprozesse erfordern vielmehr das Verlernen alter und das Erlernen neuer Routinen, wobei dies kein individueller, sondern ein teambasierter Prozess ist, der zudem im Rahmen einer Organisation verläuft, welche die Rahmenbedingungen für Veränderungsprozesse vorgibt und durch diese Prozesse selbst verändert wird. Um die Nachhaltigkeit von Veränderungsprozessen sicherzustellen, wird von McCormack et al. (2013) das Modell der Praxisentwicklung vorgeschlagen ( 
Kap. 4
), das auf einer Verbindung von Personal- und Organisationsentwicklung basiert und als Bottom-up-Ansatz auch eine Beibehaltung von bewährter Praxis und damit eine vom Pflegeteam mitbestimmte Übernahme neuer Praktiken erlaubt.
Ein Blick auf die Homepages diverser Kliniken und Pflegeeinrichtungen lässt allerdings die Frage aufkommen, inwieweit die dort verfolgten Ansätze die Komplexität von Implementierungsprozessen und den mit ihnen verbundenen Arbeitsaufwand berücksichtigen. Eine Pflegewissenschaftlerin in der Stabsstelle einer Universitätsklinik oder ein Referent für einen ganzen Verband von Kommunalkrankenhäusern werden den vielfältigen Anforderungen der betreffenden Einrichtungen kaum gerecht werden können. Mit Hilfe von Internetrecherchen lassen sich zwar recht leicht Konzeptpapiere erstellen, es ist jedoch fraglich, ob der Außenwirkung, die sich durch ihre Publikation auf der Homepage der Einrichtung erreichen lässt, eine Tiefenwirkung entspricht, durch die sich die Arbeitsprozesse der Einrichtung tatsächlich verändern. Analog zur Scheinerkenntnis der Forschung kann sich auch eine Scheinentwicklung der Praxis verbreiten.
2.8 Innovation im Dienste der Person?
Aber selbst wenn die Forschung sich auf die Einhaltung von Standards zur Durchführung von Studien verpflichtet und Praxiseinrichtungen die Bereitschaft zu einem langwierigen Entwicklungsprozess aufbringen, bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet: Ist die beständige Optimierung der Gesundheitsversorgung überhaupt patientengerecht? Zu Ende gedacht, dient dieser fortwährende Optimierungsprozess einer immer weitergehenden Verlängerung des Lebens. Dies macht allerdings nur dann Sinn, wenn die mit dem Alter assoziierten Degenerationsprozesse vermeidbar sind. In einem vielbeachteten Artikel erklärten Rowe und Kahn (1987), dass ein solches Altern möglich sei, da ein gesundheitsförderlicher, aktiver Lebensstil zu einer weitgehenden Vermeidung altersbedingter Funktionseinbußen führen könne. Der Mensch müsse nur dazu bereit sein, sich selbst zu optimieren. Diese These wird vom israelischen Schriftsteller Yuval Noah Harari in seinem Buch Homo Deus radikal zu Ende gedacht und als eine reale Möglichkeit für die zukünftige Entwicklung der Menschheit angesehen: »Nachdem wir ein beispielloses Maß an Wohlstand, Gesundheit und Harmonie erreicht haben und angesichts unserer vergangenen Bilanz und unserer gegenwärtigen Werte werden die nächsten Ziele der Menschheit wahrscheinlich Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit sein.« (Harari 2017, S. 34)
Kritiker dieser Zukunftsvision machen allerdings darauf aufmerksam, dass diese bestenfalls eine leere Worthülse sei. Durch die Abschaffung des Todes wird die Grundbedingung des Lebens mitbeseitigt. Erst durch das Bewusstsein von der eigenen Sterblichkeit erhält das menschliche Leben seine eigentliche Bedeutung. Unsterblich-Sein hingegen kann nur bedeuten: »Das Leben würde dahinplätschern, immer weiter, ohne Ende, aber auch ohne Ziel« (Fuchs 2020, S. 95) und jede Entscheidung, die man träfe, wäre genauso gut wie jede andere, denn beim nächsten Mal könnte man ja das zuvor Ausgeschlossene wählen. Ein dauerhaftes Glück wäre zudem nur ein Widerspruch in sich selbst, da Glück seinem Wesen nach zerbrechlich und nur in einzelnen Momenten erfahrbar ist (Zaborowski 2019). Es entspräche einem Leben ohne Höhen und Tiefen, die für die Glückserfahrung die Voraussetzung sind und führe daher zu Gleichgültigkeit und Langeweile.
Eine permanente Optimierung der Gesundheitsversorgung mit dem Ziel der Unsterblichkeit würde damit letztendlich das Gegenteil von dem bewirken, was sie erreichen will, da sie sich einseitig am Kriterium einer optimale Funktionstüchtigkeit und Gesundheit orientiert, und nicht an dem, was die Patienten am Ende ihres Lebens für sich als sinnvoll erfahren.
2.9 Innovation – ein erweiterter Begriff
Gesundheit und langes Leben sind damit kein absolutes Ziel. Gerade im Kontext der gerontologischen Pflege wird dies deutlich. Hier geht es nicht nur um die Frage nach dem Erhalt des Lebens, sondern auch um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende. Die Pflege alter Menschen ist mit den Grenzen der Medizin und der Machbarkeit konfrontiert und muss lernen, diese anzuerkennen. Das heißt natürlich nicht, dass Innovationen in der Gerontologie keine Rolle spielen. Auch Hospize und Palliativstationen sind eine Innovation. Allerdings sind sie nicht unbedingt Orte der Optimierung im Sinne einer effektiven und effizienten Erreichung von Outcomes. Es ist nicht ihr Anliegen, die Patienten möglichst kostengünstig und schnell aus dem Leben zu entfernen. Vielmehr geht es ihnen darum, den Sterbenden Zeit und Raum zu geben, um sich vom Leben zu verabschieden und auf ihren Tod vorzubereiten. Dabei spielt zwar eine Linderung von körperlichen Beschwerden eine Rolle, die es auch wünschenswert macht, nach verbesserten Methoden der Symptomlinderung zu suchen, allerdings kommt der entsprechenden Behandlung nur eine unterstützende Funktion zu. Der eigentliche Sterbeprozess kann und soll dem Sterbenden nicht abgenommen werden.
Da Hospize eine Innovation darstellen, die aus einer Kritik an der einseitigen Orientierung der Kliniken an einer gesundheitsbezogenen Ergebnisverbesserung entstanden sind, scheint es ratsam den Innovationsbegriff und die daraus sich ableitende Vorstellung ihrer Implementierung zu erweitern. Implementierung kann hier nicht einseitig auf evidenzbasierte Prozessoptimierung hinauslaufen. Dies bedeutet nicht, dass eine Evidenzbasierung von Pflegemaßnahmen überflüssig oder gar abzulehnen wäre. Es kommt jedoch auf einen angemessenen Umgang mit Forschungsergebnissen an. Diese können nur sagen, was machbar und effektiv ist. Die Frage, ob die von ihnen getesteten Maßnahmen den Bedürfnissen der Kranken und Pflegebedürftigen entsprechen oder nicht, wird von ihnen nicht beantwortet. Dies kann nur im Rahmen eines Dialogs mit den Pflegebedürftigen geschehen, der den Aufbau einer Vertrauensbeziehung erforderlich macht.
In diesem Kontext verdient das Konzept der person-zentrierten Pflege nach Kitwood (2000) Beachtung, welches auch in den kürzlich erschienenen Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz (DNQP 2019) Eingang gefunden hat. Auch dieses fordert eine Verabschiedung einer auf Funktionalität und Effizienz ausgerichteten Pflege und die Entstehung einer neuen Pflegekultur, in der durch Pflegeangebote offene Situationen entstehen, in denen sich die Pflegenden auf die Bedürfnisse der Pflegeempfänger einlassen und ihnen so Sinnfindung und Selbstbestimmung ermöglichen. Der Unterschied zwischen der alten und der anvisierten neuen Pflegekultur lässt sich anhand der von Heidegger (1979) geprägten Begriffe einer einspringenden und einer vorausspringenden Fürsorge verdeutlichen. Unter einer einspringenden Fürsorge versteht Heidegger eine Fürsorge, die für die Pflegebedürftigen und an ihrer Stelle Entscheidungen trifft und sie durch das Abnehmen ihrer Sorge um sich selbst zu Abhängigen und Beherrschten macht (ebd. S. 122). Sie führt im Extremfall zu einem Überprotektionismus und versteht dabei Pflege in einem rein technologischen Sinn, weil sich Pflegebedürftigen ihre Sorge um sich selbst nur dann abnehmen lässt, wenn man davon ausgeht, dass man sie einer Behandlung unterziehen kann, die dann mehr oder minder zuverlässig zu gewünschten, messbaren Outcomes führt. Wird diese Haltung verabsolutiert, werden Pflegebedürftiger zu behandelbaren Objekten degradiert, die lediglich dazu dienen, anhand von statistischen Kennwerten die Behandlungserfolge der Einrichtung zu demonstrieren.
Читать дальше