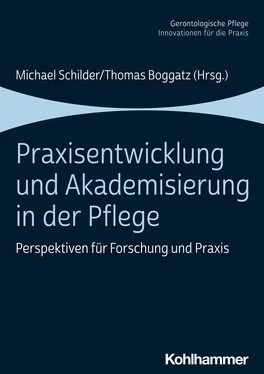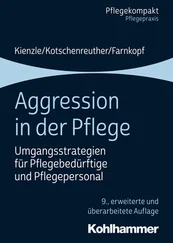Wenn die Wissensproduktion derart die Aufnahme- und Verarbeitungskapazität der Anwender von Forschungsergebnissen übersteigt, wird sie offensichtlich nicht durch eine Nachfrage aus der Praxis ausgelöst. Dies zeigt sich deutlich im Prinzip der Open Access Publikationen, die laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Standard des wissenschaftlichen Publizierens in Deutschland werden sollen (BMBF 2016). Wissenschaftliche Publikationen sollen so frei im Internet zugänglich werden, wobei die Publikationskosten durch die Forscher bzw. eine Subvention durch Fördergelder getragen werden. Unter der Prämisse, dass die Praxis der Absatzmarkt für Forschungsergebnisse ist, ergibt eine freie Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen allerdings keinen marktwirtschaftlichen Sinn, da hier ein Produzent dafür bezahlen muss, dass ihm sein Produkt abgenommen wird. Eine Bäckerei könnte nicht überleben, wenn sie die Kundinnen für die Abnahme ihrer Brötchen bezahlen müsste.
Die Produktion von Wissen scheint damit einer Eigenlogik zu folgen, bei der der Forschungsbetrieb beständig neue Fragen stellt, um sich selbst zu erhalten. Erst im Nachhinein zeigt sich dann die Notwendigkeit, eine Zielgruppe für die Ergebnisse der Forschung in der Praxis zu finden, um diese beständige Produktion von Wissen zu legitimieren. Studienergebnisse, die keine Verwendung finden, mögen im Rahmen von Grundlagenforschung akzeptabel sein, weil sie ein Ideenreservoir generieren, dessen Nutzen sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erweist, im Rahmen von anwendungsorientierter Forschung haben sie jedoch keinen Wert – es sei denn, es gelingt, eine Nachfrage nach ihnen zu erzeugen, indem man der potenziellen Zielgruppe einen Bedarf aufzeigt, den diese selbst bislang noch nicht erkannte. Durch die Produktion von neuem Wissen entsteht somit erst ein Innovationsbedarf in der Praxis, dem dann durch Implementierung externer Evidenz entsprochen werden soll.
2.6 Innovation als wertloses Wissen
Die Entkopplung der Wissensproduktion vom unmittelbaren Verwertungsbedarf der Praxis dient jedoch nicht immer einem Gewinn von Erkenntnis im Interesse der Wahrheit und einer Entwicklung verbesserter Behandlungsmethoden, die der Praxis dann uneigennützig zum Wohl der Kranken zur Verfügung gestellt werden können. Das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e. V. (Sänger 2016) und auch Cochrane Deutschland (2015) beklagen auf ihren Tagungen vielmehr eine erhebliche Produktion von Studien mit zweifelhaftem Wert. Ioannidis et al. (2014) zu Folge weisen viele veröffentlichte Studien Schwächen in der Konzeption, Durchführung und Analyse auf. Das Fehlen detaillierter schriftlicher Protokolle und eine mangelhafte Dokumentation seien weit verbreitet, die statistische Aussagekraft der Studien sei oft zu gering oder die Statistik werde durch eine willkürliche Wahl der Analysen in irreführender Weise verwendet. Die von den Studien festgestellten Effekte können dabei variieren, je nachdem welche Variablen in statistische Anpassungen einbezogen werden, welche statistischen Modelle zur Anwendung kommen, welche Definitionen und Messverfahren für Ergebnissen und Prädiktoren und welche Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienpopulation verwendet werden. Dass auf diese Weise Scheineffekte ermittelt werden, sei unter anderem auf eine unzureichende Ausbildung der Forschenden in Forschungsmethoden und auf die fehlende Einbeziehung von statistischer Expertise zurückzuführen.
Die gleiche Kritik betrifft Paley (2017) zu Folge auch qualitative Studien. Um den Publikationsoutput zu erhöhen und schon Masterabsolventen eine Publikation zu ermöglichen, seien im wissenschaftlichen Diskurs Methoden legitimiert worden, die dem engen Zeitrahmen und den beschränkten Ressourcen solcher Abschlussarbeiten entsprächen. »The academic environment has selected for whatever can be achieved in less than a year, and methodologists have adopted philosophical ideas in order to provide a justification« (Paley 2017, S. 10). Interviewstudien mit kleinen Stichproben, die zwecks angeblicher Unbefangenheit ohne theoretischen Hintergrund geplant würden, sich auf eine reine Beschreibung von Erfahrungen beschränkten und mithilfe eines einfachen Rezepts ein paar Kernthemen identifizierten, entsprächen diesen Anforderungen am besten. Derart gewonnene Forschungsergebnisse – gleichgültig ob qualitativer oder quantitativer Art – seien daher im Grunde wertlos.
Dass Forschende trotz wiederholter Appelle und der Erstellung von Leitlinien wie z. B. durch das Equator Network ( www.equator-network.org) Studien von zweifelhafter Qualität produzieren, scheint systembedingt zu sein. Forschung erhält nicht durch ihre Bewährung in der Praxis, sondern durch ihre Publikation ihre Bedeutung. Ioannidis et al. (2014) zu Folge gibt es dabei einen stärkeren Anreiz zur Produktion von Quantität als von Qualität. »Although publication of research is essential, use of number of publications as an indicator of scholarly accomplishment stresses quantity rather than quality. With thousands of biomedical journals, nearly any manuscript can get published« (Ioannidis et al. 2014, S. 171). Forschende konkurrieren so um die Anzahl ihrer Publikation und unterliegen damit einem Publikationszwang, der ihnen schon in ihrer Sozialisation mit der Maxime »publish or perish« vermittelt wird. Da es schwierig ist, durch detaillierte Forschungsarbeit den erforderlichen Publikationsoutput zu erreichen, werden durch diese Maxime Studien von zweifelhaftem Wert provoziert.
Darüber hinaus, so Ioannidis (2014), sei es in diesem Wettlauf um Publikationen wichtiger, Neues zu präsentieren, als zuverlässige Forschung zu betreiben, da dies mehr Aufmerksamkeit beim Publikum erzeuge. Hinzu komme die Bedeutung, die dem Einwerben von Fördergeldern zugeschrieben werde, was Forscher dazu verführe, übertriebene Resultate zu versprechen und zu publizieren, um weitere Fördergelder zu bekommen (ebd.). Nicht zuletzt spielt auch der Einfluss von Interessensgruppen bei der Forschungsförderung eine Rolle. Das Testen von innovativen Pflegemaßnahmen kann so im Interesse einer Vermarktungsstrategie instrumentalisiert werden. Auch wenn die Forschung nicht direkt auf eine Nachfrage aus der Praxis angewiesen ist, unterliegt sie dennoch einem Wettbewerb um Reputation und Fördergelder, der dazu führt, dass sie zumindest teilweise in einen Widerspruch zu ihrem eigentlichen Erkenntnisinteresse gerät. Der Wert von Innovation durch Forschung ist damit zweideutig.
2.7 Innovation als Scheinentwicklung
Wird die Praxis als Anwender von Forschungsergebnissen mit Informationen überhäuft, von denen ein Teil zweifelhaft und wertlos ist, ist eine kritische Bewertung von Studien notwendig, um die Spreu der Forschung von deren Weizen zu trennen, bevor eine Implementierung forschungsgestützter Problemlösungen erfolgen kann. Die oben skizzierte Problematik der Glaubwürdigkeit von Studien erfordert allerdings ein erhebliches Maß an forschungsmethodischen Kenntnissen, um deren Einschränkungen zu durchschauen.
Dies wirft jedoch die Frage auf, ob Bachelorstudiengänge ihre Absolventinnen und Absolventen im Rahmen ihrer relativ kurzen Dauer, die in einigen Fällen die einer dreijährigen Berufsausbildung nicht übersteigt, adäquat auf diese Aufgabe vorbereiten können – zumal dann, wenn sie im Rahmen einer generalistischen Ausbildung ohnehin schon sehr breite Wissensbestände vermitteln müssen. In Bachelorarbeiten wird zwar oftmals eine kritische Bewertung von Studien versucht, die Vorträge auf Hochschultagen, die solche Arbeiten vorstellen, laufen jedoch zumeist nur auf die unhinterfragte Nennung einer Anzahl signifikanter Studienergebnisse hinaus und lassen so eher eine Studiengläubigkeit als eine kritische Haltung ihnen gegenüber erkennen. Die Publikation von Bachelorarbeiten auf Hochschultagen und Internetplattformen kann so zu einer Dissemination von zweifelhaften Forschungsergebnissen führen und trägt im schlimmsten Fall zur Einführung eines neuen Pflegerituals bei, dass darin besteht, für jede Maßnahme, die man zu implementieren gedenkt, auf eine beliebige Studie zu verweisen, so als ob dieser Verweis die Wirksamkeit der Maßnahme sicherstellen könne. Anstatt der Praxis durch nachvollziehbare Beweise den Sinn und Nutzen ihrer Maßnahmen darzulegen und so zur Abschaffung unnützer Rituale beizutragen, hat sich der Versuch ihrer Aufklärung in sein dialektisches Gegenteil verkehrt und befördert lediglich eine neue Hörigkeit, die sich dieses Mal nicht auf Eminenzen wie den Oberarzt oder die Pflegedirektorin, sondern auf nur halb verstandene Evidenzen bezieht.
Читать дальше