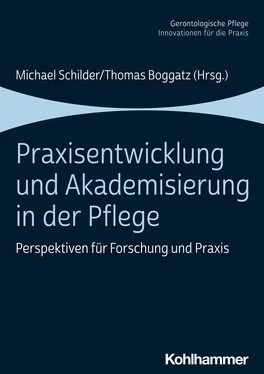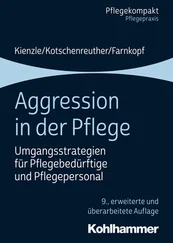2Howaldt et al. (2014, S. 13) bezeichnen »soziale Innovationen in einem nicht normativ angelegten analytischen Konzept als intentionale Neukonfiguration sozialer Praktiken« (Howaldt et al. 2014, S. 13). Wenn man an Praxisentwicklung im Pflegesektor denkt, dann ist zu diskutieren, ob dieser Ansatz letztlich ausreicht und nicht vielmehr inhaltlich-fachliche Begründungen einer guten Pflege stärker mit berücksichtigt werden sollten.
Teil I Praxisentwicklung: Erfordernisse im Kontext gesellschaftlicher Entwicklung
1 Theorie und Praxis in der Pflege – Anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis
Hermann Brandenburg
Zusammenfassung
In einem ersten Schritt erfolgen einige Hinweise zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Als Praxiswissenschaft muss die Pflegewissenschaft über Verbindungen zwischen den genannten Bereichen nachdenken und die Frage beantworten, wie diese zu gestalten sind. Das ist nicht einfach, die Herausforderung wird aufgezeigt. Im zweiten Schritt befasse ich mich mit empirischen Befunden dahingehend, wie diese »Umsetzung« von neuem und wissenschaftlich basiertem Wissen in die Praxis gelingen kann. Die Rolle des »Facilitators« ist hier sehr wichtig. Aber es reicht nicht eine/n Verantwortliche/n zu identifizieren, auf die Organisationen kommen Veränderungen zu, die »wehtun« müssen (oder können). Ein pragmatischer Zugang (ergänzt durch eine kritische Perspektive) – so die zentrale Aussage im dritten Teil dieses Beitrags – könnte eine Orientierung sein. Den Abschluss bildet ein Hinweis auf die Notwendigkeit eines fairen Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis.
Schlüsselwörter: Theorie, Praxis, Pragmatik, Kritik
Wenn man die Begriffe »Theorie« und »Praxis« hört, dann denkt man an unterschiedliche Dinge – je nach Standpunkt. Seitens der Theorie (das sei an dieser Stelle einmal unzulässiger Weise mit Wissenschaft und/oder Forschung gleichgesetzt) geht es darum, ein bestimmtes Phänomen oder einen Sachverhalt möglichst genau zu beschreiben, die beeinflussenden Faktoren herauszuarbeiten und möglicherweise Aussagen über weitere Verläufe zu treffen, d. h. Prognosen aufzustellen. Und die Praxis beschreibt ein breites Feld, dazu gehört nicht nur die Aufgaben direkt am Patienten bzw. Bewohner. Praxis wird bestimmt durch organisatorisch-personelle Bedingungen vor Ort, ist eingebettet in institutionelle Logiken und wird bestimmt durch externe finanzielle und politische Rahmenbedingungen.
Schauen wir uns einmal das Spannungsfeld von Theorie und Praxis genauer an. Als Beispiel beziehen wir uns auf die Beziehungsgestaltung bei der Pflege von Menschen mit Demenz. Von der Gerontologin Naomi Feil wurde hierzu die in der Altenpflege bekannte Methode der Validation entwickelt, die für jedes Stadium der Demenz eine passende Kommunikationstechnik beschreibt (Feil 2000). Wie Dammert et al. (2016) in einer Studie feststellen mussten, lässt sich diese in Schulungen so einfach erscheinende Technik in der Praxis jedoch kaum umsetzen. Die Gründe hierfür, welche die Pflegepersonen angaben, waren vielschichtig. Neben einschränkenden, institutionellen Rahmenbedingungen wie Personal- und Zeitmangel und fehlender Unterstützung durch die Leitungsebene, erwies sich die Validation als nicht vereinbar mit der Aufgabenstellung und den Arbeitsgewohnheiten der Pflegenden. Verweigerte zum Beispiel ein Bewohner die Körperpflege, so konnte darauf nicht validierend eingegangen werden, da der Arbeitsauftrag der Pflegenden und die Erwartungen der Angehörigen darin bestanden, die Körperpflege und Hygiene des Bewohners sicherzustellen. Aber neben diesen konkreten praktischen Problemen lassen sich auch im Hinblick auf die Theorie gewisse Rückfragen stellen. Denn man kann durchaus darüber diskutieren, ob die These von Feil, dass die Demenz letztlich nur die Auseinandersetzung mit unerledigten biografischen Themen darstellt und ihr letztlich kein neurologisch bedingtes Substrat zugrunde liegt, haltbar ist (vgl. ausführlicher Boggatz 2022). Wir sehen also bereits an diesem einfachen Beispiel, dass die einfache »Übersetzung« von theoretischen Überlegungen in die Praxis nicht ganz so einfach ist. Zum einen kommt es natürlich auf den theoretisch-wissenschaftlichen Hintergrund an, der muss stimmen und zumindest keine grundlegenden Fragen aufwerfen. Das gilt auch für die Praxis, welche für die Aufnahme neuer Ansätze und Strategien offen sein muss. Und schließlich – drittens – muss man Überlegungen darüber anstellen, was man tun kann, um den »gap« von Theorie und Praxis zu reduzieren. Man könnte sagen, dass die entsprechenden Versuche legendär sind und die vor allem US-amerikanisch beeinflusste Debatte die Pflegewissenschaft über Jahrzehnte befruchtet haben (vgl. die mittlerweile klassischen Texte von Dickhoff et al. 1968 a, b; Beckstrand 1978, Mars & Lowry 2006).
Auf zwei Aspekte möchte ich im Folgenden etwas genauer eingehen. Der eine bezieht sich darauf, wie in der Pflegewissenschaft das Verhältnis der beiden genannten Pole (sind es wirklich zwei Pole?) bestimmt wurde; hier kann man grob zwischen Positionen unterscheiden, welche einerseits die Unterschiede betonen oder anderseits die gegenseitigen Verbindungen stark machen. Neben dieser wissenschaftstheoretisch imprägnierten Perspektive (vgl. Brandenburg 2016) möchte ich – zweitens – auf die Empirie blicken. Denn unser Verhalten im Alltag wird (sowohl bei Wissenschaftlern wie auch bei Pragmatikern) durch die Eigenlogik der jeweiligen Systeme bestimmt, in denen wir uns bewegen (vgl. hierzu grundlegend Schulz-Nieswandt 2020). Inwieweit erlauben es uns die damit verbundenen Zwänge und Arbeitskulturen eigentlich, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen? Und zwar sowohl von Seiten der Theorie wie von jener der Praxis. Das alles klingt schon recht skeptisch, mein Ausblick ist aber positiv und stellt zwei Begriffe ins Zentrum: Pragmatik und Kritik.
1.2 Das Verhältnis von Theorie und Praxis in der pflegewissenschaftlichen Diskussion
Eine ganze Reihe von Pflegetheoretikerinnen hat ihr Augenmerk darauf gelegt Theorien zu entwickeln, die letztlich in die Praxis überführt und diese mit einer bestimmten Agenda verknüpfen sollen; die sog. »grand theories« (z. B. King, Peplau, Orem, Rogers) sind nur ein Beispiel. Die später als »middle range« (Mishel’s uncertainty in illness, Norbeck’s model for social support, Swanson’s theory of caring) oder als »situation specific« (die vor allem auf klinische Herausforderungen im engeren Sinne fokussiert sind) ausbuchstabierten theoretischen Ansätzen zeigen, dass die Theorieentwicklung in den USA elaboriert und weit fortgeschritten ist (für einen Überblick vgl. Nicoll 1997, Reed et al. 2012; für die dt. Diskussion vgl. z. B. Schröck & Drerup 1997, Moers & Schaeffer 2000, Brandenburg & Dorschner 2021).
Es lassen sich eine ganze Reihe von theoretischen Überlegungen zusammenfassen, welche die Trennung von Theorie und Praxis akzentuiert haben. Hier wurde postuliert, dass die theoretischen Positionen noch nicht ausreichend spezifiziert wurden, um einen body of knowledge für die Pflege zu generieren. Pflege(-wissenschaft) – so die Annahme – kann noch nicht als Kompass für eine veränderte Praxis angesehen werden, denn: »the practice of nursing is still directed by medical orders and institutional policy rather than beeing grounded in the findings of nursing reasearch (Jacobs & Huether 1978, S. 67). Als zentrale Barrieren wurden die fehlende Bereitschaft für die Aufnahme neuer Ideen in der Praxis, die zunehmende Diversität im Pflegesektor sowie ein Anti-Intellektualismus identifiziert. Man kann aber auch das Trennungsargument seitens der Praxis stark machen. So hat z. B. Smith eindeutig Stellung bezogen und die Frage gestellt, warum eigentlich Pflegende an der Basis »must be afflicted with baroque nursing theories couched in stilted pseudo-intellectual jargon … Who, besides academic luminaries, benefits from this blizzard of inflated words?« (Smith 1981, S. 83).
Читать дальше